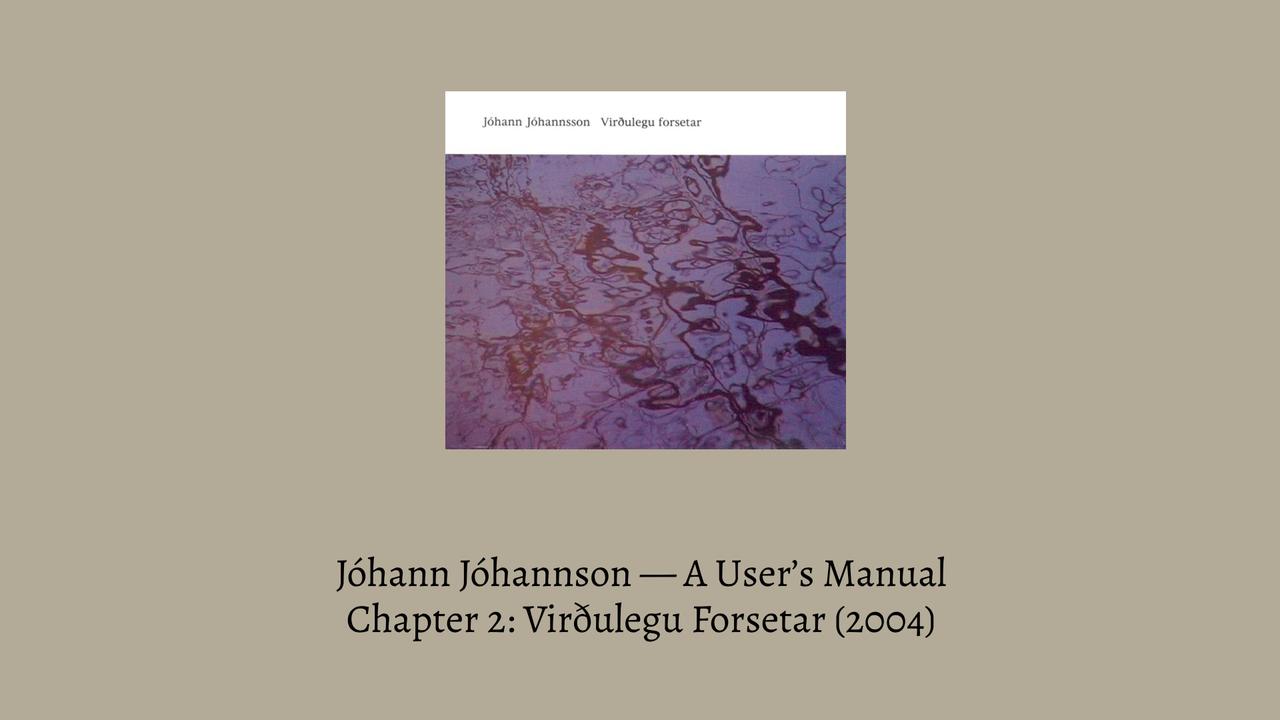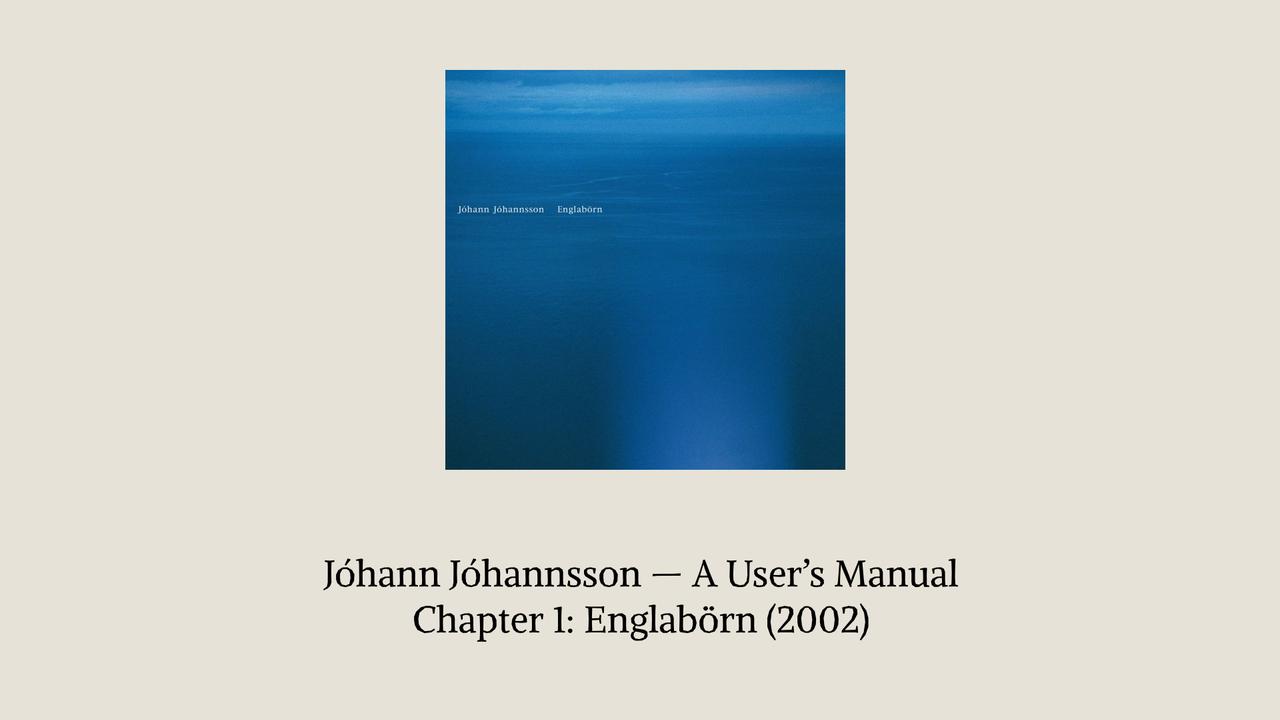Haunting und taktil – mitunter donnerndEmeka Ogboh, Alina Kalancea, Floating Points – 3 Platten, 3 Meinungen
24.3.2021 • Sounds – Gespräch: Christian Blumberg, Kristoffer Cornils, Thaddeus Herrmann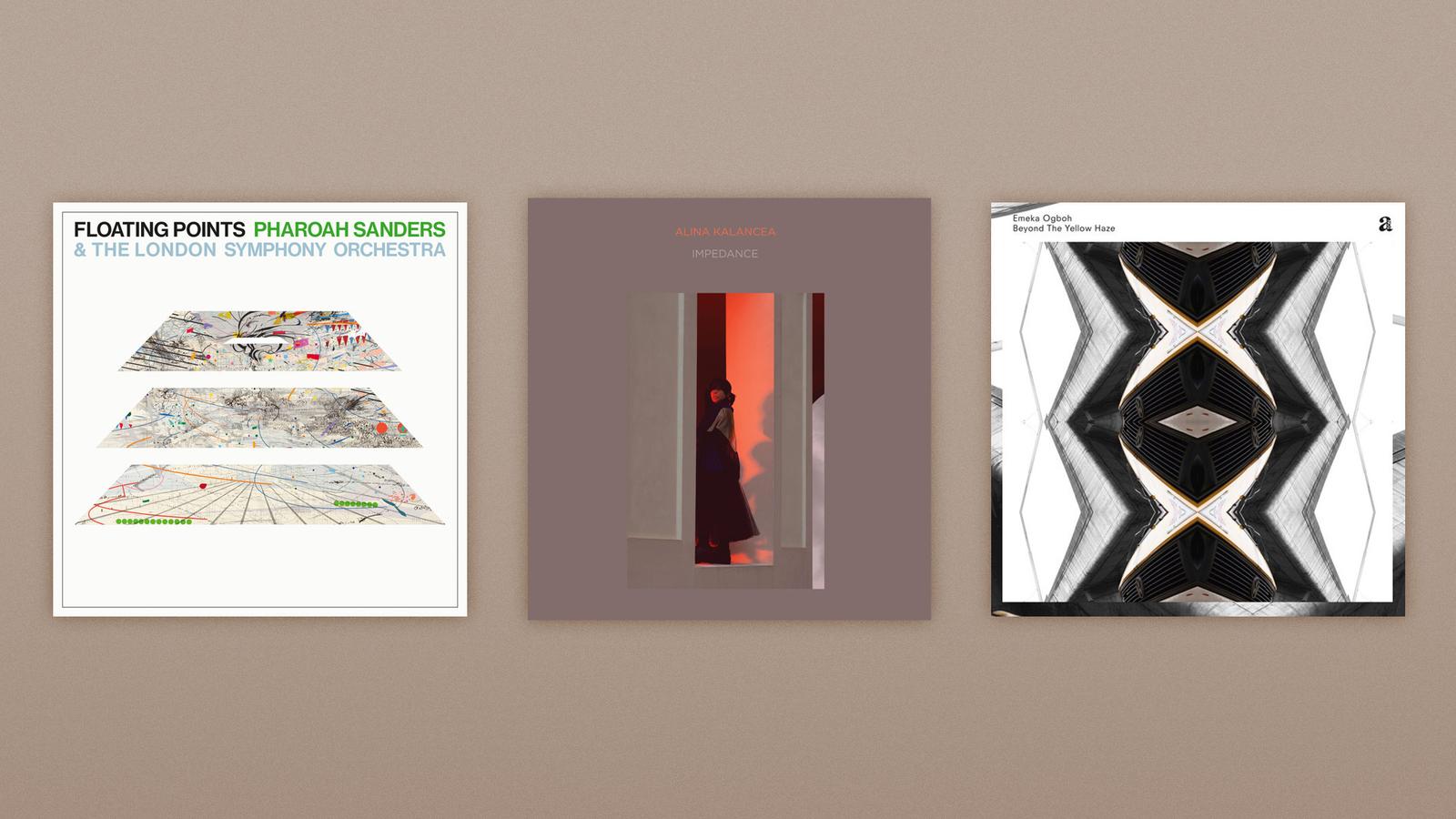
Zwischen vielschichtiger Klangforschung für den kleinen Floor, bewusst enthallter Modular-Komposition und minimalem Dialog aus Elektronik, Saxofon und Orchester akkordschüppen Blumberg, Cornils und Herrmann Sanddünen für den musikalischen Rundblick im März 2021 auf.
Und weil es mit den Wonnen des Mai eben noch ein paar Wochen dauert, beamt sich das Trio zunächst in die Welt des interdisziplinär arbeitenden Künstlers Emeka Ogboh, der Field Recordings aus Lagos als Basis für seinen Dancefloor-Landeanflug nimmt. „Beyond The Yellow Haze“ ist schon jetzt eines der Alben des Jahres, nicht nur weil die Musik auch ohne ihren eigentlichen Anlass – eine Ausstellung – mitreißt. Virtuell sonnenbetankt geht es weiter zu der aus Rumänien stammenden Musikerin Alina Kalancea. Auf „Impedance“ stellt sie ihr ganz eigenes, von Hardware getriebenes Sound Design zu Disposition. Für maximale Klarheit sorgt dabei das Weglassen der üblichen Effekte. So ist man näher dran am Geschehen. Überraschend nah dran zeigt sich auch das neue Album von Floating Points, das er zusammen mit dem Saxofonisten Pharoah Sanders und dem London Symphonic Orchestra aufgenommen hat. Warum es dabei ein Orchester brauchte? Schauen wir mal. Derweil erschrickt sich Blumberg bei einem nächtlichen Spaziergang ob stereophonischer Verkehrsgeräusche, Cornils entdeckt den Acid hinter Patchbays und Herrmann debattiert die Bedeutung des Easy Listening vor dem Hintergrund des Generationen-Konfliktes. Kurz und gut: Ordentlich reingehanszimmert. Bzw.: The boys are back on the internet.
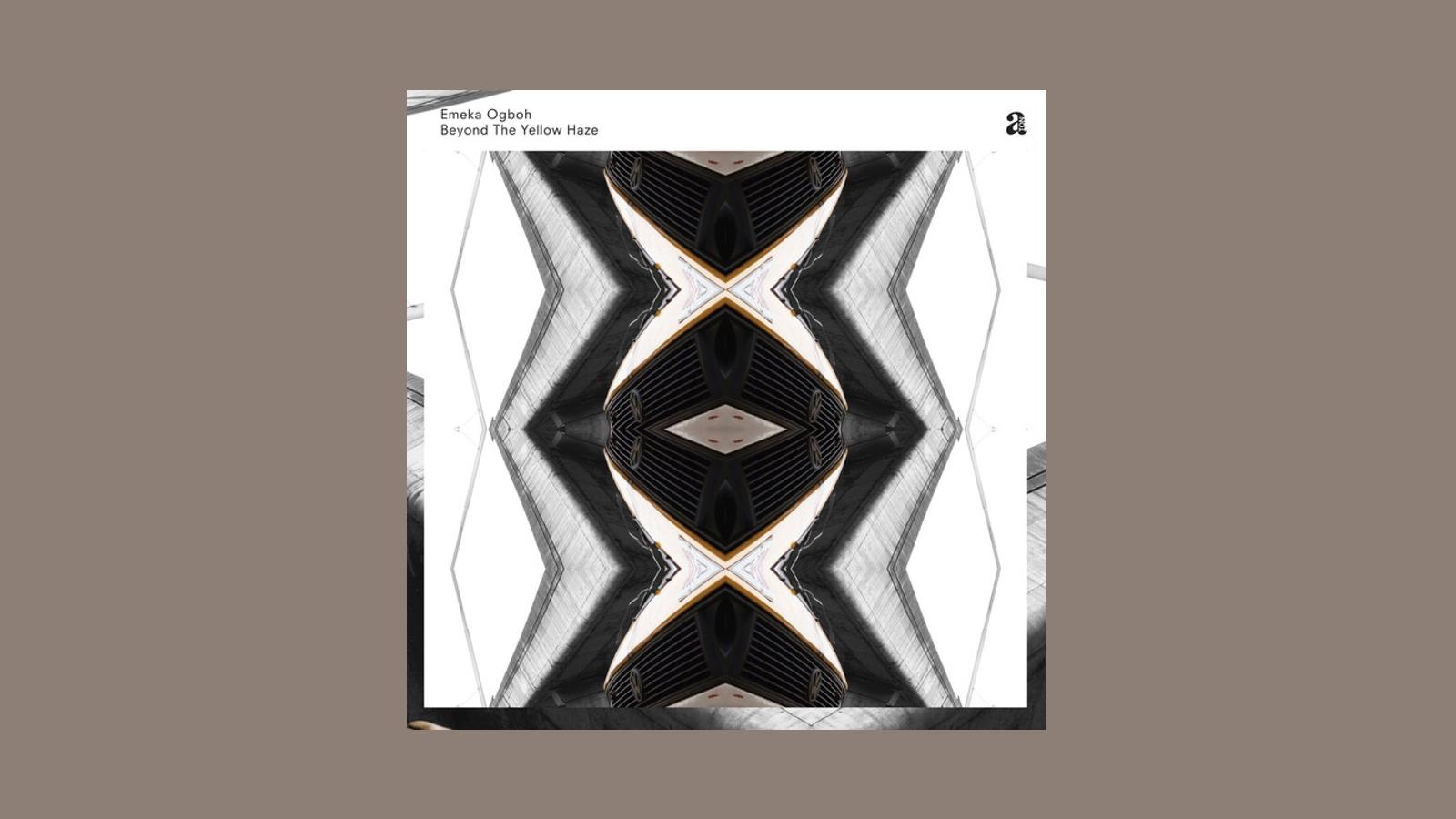
Emeka Ogboh, Beyond The Yellow Haze, ist auf A-Ton erschienen.
Emeka Ogboh – Beyond The Yellow Haze (A-Ton / Ostgut Ton)
Christian: Emeka Ogboh ist bildender Künstler, kommt aus Nigeria, lebt seit Jahren in Berlin und Sound ist eine wichtige, aber bei weitem nicht die einzige Facette seiner Arbeiten. In Dresden hat er dieses Jahr eine Reihe von Plakaten aufgehängt, als Intervention im öffentlichen Raum. Es geht um die Debatte um koloniale Raubkunst in westlichen Museen. Sie zeigen die Benin-Bronzen aus der Sammlung des Dresdener Museums für Völkerkunde als Vermisstenanzeigen: „Vermisst in Benin“. Solltet ihr die letzte „documenta“ besucht haben, habt ihr vielleicht ein Bier getrunken, das Ogboh dafür brauen ließ. Es hieß Sufferhead, schmeckte nach Honig und Chili und war dezidiert nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Stattdessen bediente es von Ogboh vorher abgefragte Geschmackspräferenzen von in Deutschland lebenden Afrikaner*innen. Ogbohs Sound-Arbeiten enthalten dagegen oft Field Recordings aus Lagos, quasi Klang-Kartografien der Stadt. Die spielen auch auf diesem Album eine große Rolle, aber in Verbindung mit Musik.
Kristoffer: Danke für das Intro. Kannst du auch etwas zu seinem Album erzählen? Ich habe mir den Pressetext dazu nicht durchgelesen und es einfach so wirken lassen. Was sehr gut funktioniert hat.
Thaddi: Bei mir war es genauso. Das Album ist bislang komplett an mir vorbeigegangen – ich bin sehr dankbar, dass ich es ob unseres Roundtables jetzt auch dem Zettel habe. Lange Zeit habe ich nicht mehr so eine wunderbar perfekte Platte bzw. Klangstudie gehört. Ich habe mir das ganz bewusst zunächst ohne den bestimmenden Kontext angehört. Es flirrte einfach vom ersten Moment an.
Christian: Zum Album erzählen kann ich eigentlich nur, dass die Musik darauf auch ursprünglich für eine Ausstellung entstand. Über welche Kanäle es dann bei Ostgut Ton gelandet ist? Weiß ich nicht genau. Wollte oben auch erstmal nur ein bisschen Bonus-Kontext geben. Wir könnten natürlich gleich die Frage stellen, ob Ogboh, der in Kassel damals dieses seltsame deutsche Kulturgut Bier politisch modifiziert hat, hier ganz ähnlich mit Clubmusik verfährt, die ja auch ziemlich hegemonial verwaltet wird. Aber vielleicht können wir das zunächst auch als ein Stück Musik hören, anstatt es gleich als Kulturvermittlung oder identitätspolitisches Statement zu lesen. Ich denke, es ist dies alles gleichermaßen.
Thaddi: Das ist ein interessanter Punkt. Während der immer noch andauernden Pandemie wurde das Berghain ja zur Galerie. Dabei gab es auch eine Installation von ihm. Nein, ich habe sie nicht gesehen. So wird jedoch die Connection zumindest klarer. Während du das gerade schreibst, läuft bei mir das Ende des zweiten Tracks „Danfo Mellow“. Schon ein großer Moment. Du berichtest über die mögliche Verzahnung der Komposition mit dem Label, also dem Vervielfältiger, und genau in diesem Moment kickt über die polyrhythmischen Field-Recordings die Snare einer 808 rein. Bin dabei!

Foto: Marco Krüger
Kristoffer: Ich auch. War ich von der ersten Sekunde an, um genau zu sein. Mein erster Gedanke war: Geil, endlich eine neue alte Shackleton! Dub ist, zumindest als Methode, ja doch schon sehr präsent und, genau, verzahnt sich wunderbar mit Groove und Klangmaterial auf dieser Platte. Die ja allerdings nicht direkt auf Ostgut Ton erscheint, sondern auf dem Ambient-Slash-Kunstmusik-Ableger A-Ton. Mit dessen Gründung hat sich Ostgut Ton ja schon etwas mehr ausdifferenziert, so wie der Club auch vor der Pandemie immer mehr den Kontakt zur Kunstwelt gesucht hat als schon zuvor – wir denken an diese Ausstellung mit Coffee-Table-Buch obendrauf zurück, an das Ballettstück und und und. Labelstrategisch also schon interessant, musikalisch aber komplett stringent: Das ist schon Dance Music, die zwar nicht auf dem Mainfloor funktionieren, immerhin aber in der Säule oder in der Halle während einer großen Oster-Party ihren Platz finden würde. Insofern nimmt das Album vieles in sich auf, was Club und Label im Gesamten angesteuert haben. Ohne jedoch so zu klingen, als sei das ihm einprogrammiert. Aber jetzt bin ich abgeschweift. Wobei ich auch gestehen muss: Ich habe fast kaum etwas über dieses Album zu sagen, als dass ich es fantastisch finde. Von vorne bis hinten. Extrem vielschichtig im Sound, wunderbar clever in den Rhythmen, da passt alles. Kommt in die Top 20 für 2021, da bin ich sicher.
Christian: Rhythmen sind ein gutes Stichwort. Vielleicht bemerkenswert: Die ersten zwei Tracks schienen mir gerade im Perkussiven fast ein bisschen altbacken. Wenn dann diese polyrhythmischen Drums einsetzen, später, klingt das Album plötzlich total zeitgemäß – ich denke an Releases von Labels wie Príncipe oder die von mir geliebte NKISI –, was die vorhin gedroppte These des Hegemonialen zumindest inhaltlich gleich wieder in Frage stellt. Auf eine gute Weise. Aber schlussendlich muss ich sagen: Am tollsten fand ich den Track ohne Rhythmen: „Palm Groove“, Titel irreführend.
Thaddi: My point exactly. Ich möchte mich eigentlich gar nicht zum vermeintlich Altbackenen äußern – das ist eine Frage bzw. ein Vergleich, der sich für mich gar nicht stellt. Ich bin ja eher immer am Flow in der Musik interessiert, ganz egal, mit was für einer Art von Sound ich es zu tun habe. Und genau dieser Anspruch wird hier fulminant eingelöst. Es passt einfach alles. Darum freue ich mich auch so sehr über dieses Album. Es verstärkt bzw. kondensiert viele meiner Interessen zu einem dichten Etwas, was einfach nur deep und im besten Sinne haunting daherkommt. Das ist schon Kopfkino im besten Sinne. Mehr Klischees fallen mir nun aber auch wirklich nicht mehr ein.
Kristoffer: Ja, der Flow sitzt und die Bilder treten in jedem Fall auf. Er setzt durch die Field Recordings natürlich auch sehr gezielt bestimmte Trigger. Aber das Stichwort Verzahnung, das vorhin fiel, ist deswegen ein schönes: Das wird alles wahnsinnig gut integriert, hier Lagos, dort Berliner Clubsozialisation. Das ist wohl sicherlich nicht kritiklos, wie ich nach Christians Vorabinformationen annehmen würde – wir haben es hier ja auch irgendwie mit einem Soundtrack für einen white cube zu tun, der sich aus der Musikgeschichte des Black Atlantic beziehungsweise der Kulisse einer afrikanischen Metropole bedient. Das ist eine Dimension, die sich zumindest mitdenken ließe. Die sich vielleicht aber auch einfach durch den Sound selbst einmal quer durch die Gehörgänge ins Gehirn windet.
Thaddi: À propos Trigger: Ich sitze jetzt seit einem Jahr im Home Office vor meinem iPad und zwei HomePods. Ich habe mich aber seitdem noch nie so erschreckt, wie bei Ogbohs Auto-Sirenen, die hier im brutal geweiteten Stereo-Panorama an mir vorbeiziehen!
Christian: Ebenso! Ich hörte das Album zum ersten Mal bei einem Nachtspaziergang durchs menschenleere Britz und war ebenfalls gut verwirrt vom Straßenlärm.
Thaddi: Ist „Palm Groove“, besagter Track ohne Beats, nun die Essenz seiner Idee oder doch eher das Fade-Out eines ganz anderen Ansinnens?
Christian: Hmm. Da ich die Show, bei der diese Musik zuerst zu hören war, nicht kenne, ist das für mich schwer zu entscheiden. Politisches – wie oben schon aufgeworfen – ist da bestimmt intentional beigegeben, aber so ein LP-Release reißt die Stücke aus diesen Kontexten irgendwie auch bewusst raus. Und allein das ist ja schon toll, dass „Beyond The Yellow Haze“ sowohl mit als auch ohne Überbau funktioniert.
Thaddi: Also einfach eine der besten Platten 2021 bislang? Wäre ich sehr mit einverstanden. Zumal – ganz ehrlich – ich beim nächsten Tonträger, dem bislang zweiten Album von Alina Kalancea, genau das nicht sagen würde. Kristoffer, du hast diese Platte ins Gespräch gebracht. Warum findest du sie interessant?

Alina Kalancea, Impedance, ist auf Important Records erschienen.
Alina Kalancea – Impedance (Important Records)
Kristoffer: Gute Frage! Das Schöne ist, dass ich die nicht ohne Weiteres beantworten kann. Und dennoch rangiert „Impedance“ wohl Ende Dezember beim jährlichen Listenschreiben noch ein paar Plätze über „Beyond the Yellow Haze“. Kurz zur Einordnung, es gibt da recht wenig zu erzählen: Kalancea kommt aus Rumänien und macht seit etwa zehn Jahren Musik. Thaddi hatte schon erwähnt, dass dieser LP eine andere vorausging. Das war’s auch fast. Kalancea arbeitet viel mit Hardware, es braucht für ihre Musik einen gewissen Grad an Geduld. Weshalb das Album auf Important Records auch bestens aufgehoben ist. Ich denke, dass ich einerseits die gewisse Statik vieler Tracks mag, die sich kaum oder nur sehr gemächlich entwickeln mag, und andererseits ein riesengroßer Fan davon bin, wie sie im Gesamten recht diverses musikalisches Material zusammenbringt. Und auch wenn der Unterschied zu Ogboh in stilistischer Hinsicht recht groß ist: Ebenso wie der ist sie eine fantastische Sound-Designerin.
Thaddi: Ich habe während der Vorbereitung auf dieses Gespräch zum ersten Mal überhaupt von Alina Kalancea gehört. Gut, nun ist auch das erst ihr zweites Album. Ich muss aber auch gestehen, dass ich ihr Debüt nicht zur Kontrolle gecheckt habe. Und will ganz ehrlich sein: Mich hinterlässt diese Komposition vollkommen ratlos. Ich oute mich dabei gerne als Nicht-Versteher. Denke gleichzeitig aber auch: Nein, das stimmt ja nicht. Denn du kennst ja den Sound von Modular-Systemen und weißt, was dich abholt und was nicht. Hier? Totale Leere. Mir fehlt die Dramaturgie, das Kompositorische. Mein Interesse pendelt zwischen kompletter Langeweile und kurzzeitiger Aufmerksamkeit. Die stellt sich dann ein, wenn – ich muss es so sagen – etwas für mich Wahrnehmbare passiert. Ob es nun die klarer definierten Attacks in den Basslines sind, was dem Ganzen mehr Grip gibt, oder die eher dunkleren Melodie-Elemente. Dann entwickelt sich so etwas wie Aktion, etwas Greifbares. Gut finde ich das dann immer noch nicht, ich kann mich aber immerhin auf ihren Pfad „einschwingen“. Das passiert jedoch viel zu selten. Mit anderen Worten: Ich bin da ziemlich raus.
„Anstatt darauf zu vertrauen, dass im Wischiwaschi schon alles irgendwie zueinander findet, besteht Kalanceas Kunst darin, dass es hier ohne solcherlei Hilfestellung geschieht.“
Christian: Ich hörte das in erster Linie schon als ein Stück Sound Design. In weiten Teilen sind die Klänge hier alle sehr direkt, sehr nah. Eine fast taktile Erfahrung. Das ist für mich schon deswegen beeindruckend, weil ich das für schwierig zu erarbeiten halte. Weil da wirklich jeder Sound sitzen muss, die Produzentin also nicht mit dieser klanglichen Nachsicht rechnen kann, die sich einstellte, würde sie nur ordentlich Hall-Effekte auf die Master-Spur pappen. Anstatt also darauf zu vertrauen, dass im Wischiwaschi schon alles irgendwie zueinander findet, besteht Kalanceas Kunst erstmal darin, dass hier ohne solcherlei Hilfestellung eben doch alles zueinander findet. Aber was sagst du Thaddi, tut es das überhaupt?
Thaddi: Ich finde nicht. Dabei unterstreiche ich zunächst deine Argumentation. Ich bin selbst kein Fan von dieser Produktionstechnik: Wenn etwas nicht passt, einfach Hall drauf. Aber mir wird hier schlicht zu wenig komponiert. Das sagt jemand, der sich stundenlang vor einen wirklich alten Synth setzen und dem Arpeggiator zuhören kann. Wenn die Maschine mit der Maschine … tipptopp. Immer, sofort, merci usw. Mir reicht das Resultat nicht. Kann man releasen, muss man aber nicht. Ich stelle dabei nicht ihren Style in Frage, sondern finde für mich schlicht keinen Mehrwert. Irgendetwas, was uns voran bringt in diesem Dschungel der musikalischen Irritation. Hier wird weder Ruhe gespendet, noch Aufregung. Es blubbert vor allem.

Kristoffer: Harte Worte! Für Sounds, die zum Teil natürlich recht schroff sind. Du hast natürlich nicht Unrecht und ich hatte Ähnliches bereits selbst gesagt: Kompositorisch ist hier nicht unbedingt viel zu holen. Oder zumindest nicht in einem Verständnis, wie es beispielsweise Ogboh anbietet, der sich ja schon noch an gängige Dynamiken entlang bewegt. Diese Platte heißt ja „Impedance“ und das schätzungsweise nicht ohne Grund. Etwas Widerständiges, Widerspenstiges ist ihr schon eingeschrieben – und ich würde niemandem zum Vorwurf machen, sich davon auch wirklich abgeschreckt zu fühlen. Das ist nur folgerichtig. Und auch ein Tracktitel wie „Master of Discipline“ ist eventuell mehr als nur vielsagend. Es geht schon um eine radikale Form von Reduktion, die in recht spröden und bräsigen Stücken resultiert – klar. Aber ich finde das in ästhetischer Hinsicht ernsthaft geil, ohne dass ich dazu auf die Konzeptebene klettern muss. Auch weil dann hin und wieder doch etwas passiert, sich beispielsweise aus „From the Dust“ langsam so eine Art Tin-Man-Acid-Techno-Track erhebt. Zwischendurch sind dann doch mal Stimmen zu hören, auf sehr rätselhafte Art und Weise. Es passiert also schon etwas, aber nicht, weil es muss oder weil der Sound es erfordert. Denn um den geht es hier meiner Auffassung nach in erster Linie. Was eben eine Fallhöhe mit sich bringt, logo: Wer die Sounds nicht mag, sich nicht von ihnen reinziehen lässt, der wird die zirkulären und manchmal schlicht auf der Stelle tänzelnden Strukturen Kalanceas auch nicht leiden können. Verstehe ich. Geht mir aber komplett anders: Ich liebe es.
Christian: Diese schroffen Stücke mit den perkussiven und glitchy Sounds und den extra trockenen, harten Bässen – da scheint sich das Sound Design oft selbst zu genügen. An diesen Passagen störe ich mich ein bisschen, einfach, weil ich diese Art von Musik immer als ein bisschen hochnäsig empfinde: Wenn Produzent*innen einerseits rumballern, ihre Tracks gleichzeitig aber total vertrackt bauen und damit die eigene Sophistication ausstellen: Too clever to be dumpf. Finde das oft eine seltsam mutlose Strategie der Absicherung. Ich glaube, das bezieht sich auch auf die brachialeren Teile von Intelligent Dance Music der 90er. Aber mit IDM, Clicks und Cuts und den damals großzügig attestierten Deleuze-/Guattari-Bezügen ging ja auch die Hornbrillisierung von Dance-Musik erst so richtig los. So toll das alles war, das hatte schon auch eine Kehrseite: Plötzlich konnte Techno auch elitistisch gehört werden. Deswegen finde ich diese Sounds erstmal gar nicht so widerständig. Vielleicht auch egal, denn erstens macht Kalancea ja gar keinen Techno und zweitens findet sie im schroffen Terrain dann doch immer einen Wendehammer: Die Passagen werden dann von samtweichen Drones unterwandert, die dich aus dem reinen Sound zurück in das Musikalische ziehen. Das hat mir dann wiederum sehr gefallen. Dachte noch, dass der Titel „Love on a concrete floor“ eigentlich das ganze Album ganz gut beschreibt. Es ist kalt und hart, aber eben auch sehr erfüllend und schön. Okay, sorry, Sex-Metapher. Ich gebe das Wort mal lieber ab!
Thaddi: Boys, ich bin raus – diskutiert das hier ruhig noch weiter, ich höre und fühle das alles leider nicht.
Kristoffer: Wir müssen das nicht unbedingt diskutieren. Wie gesagt halte ich „Impedance“ für eine tolle Important-Platte: Es geht um Räumlichkeit, um Zeitlichkeit, um Klanglichkeit. Müssen die Ohren schon für eingestellt sein. Meine sind es und sie werden also belohnt. Eingängiger allerdings ist das, was Floating Points gemeinsam mit Pharoah Sanders und dem, Achtung, London Symphony Orchestra zusammengeführt hat. Und darüber kannst du jetzt aber schon diskutieren, oder Thaddi? Mich würde interessieren, was du an dem Album interessant findest.
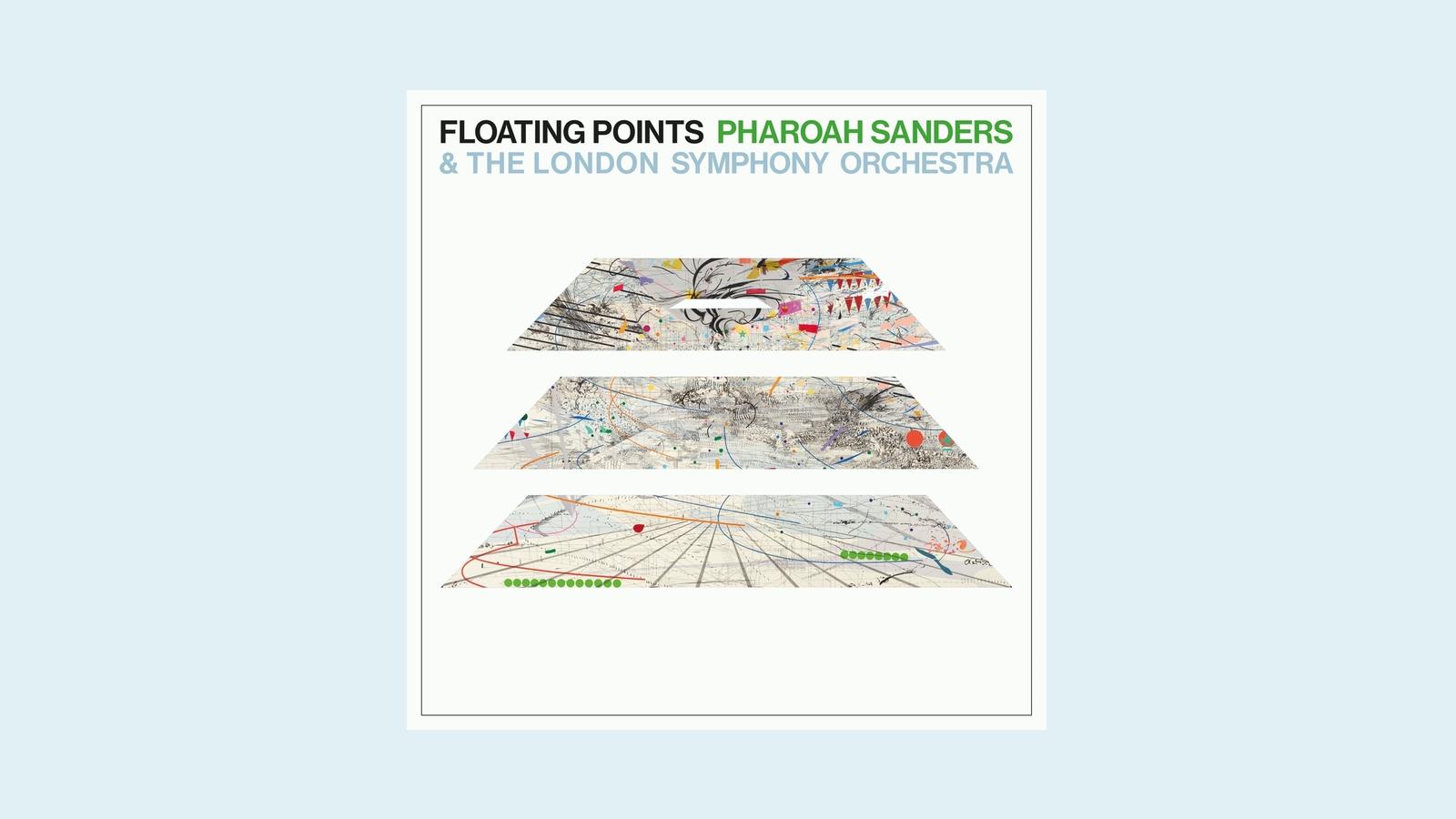
Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra, Promises erscheint am 26. März auf Luaka Bop.
Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises (Luaka Bop)
Thaddi: Ich habe mal im Archiv gekramt. Das letzte Mal, dass Floating Points bei uns in einem Roundtable verhandelt wurde, war Ende 2015, damals noch mit dem Kollegen Michael Döringer, zum Album „Elaenia“. Ich schrieb: „Das ist eine tolle Platte, die aber vollkommen an mir abperlt.“ Ich gebe zu, dass ich spätestens seitdem die Entwicklung von Sam Shepherd nicht mehr wirklich verfolgt habe. Ich hatte ihn und seine Musik mehr oder weniger abgehakt. Mir war das alles zu ambitioniert. Was schon eine ziemlich arrogante Ansage ist, das gebe ich gerne zu. Aber: Seine Ideen sprachen nicht zu mir, und ich hatte das Gefühl, dass everybody’s darling nicht auch noch meine Unterstützung bräuchte. Oder mein – wahrscheinlicher – Bitching. Soll er bei der BBC rauf und runter laufen, mit X und Y arbeiten etc. – mir egal. Ich steckte ihn in die Four-Tet-Schublade, der mir mit seinem musikalisch gänzlich anderem Entwurf ebenso auf die Nerven ging. Als neulich dann die Promo-Mail zum neuen Album von Shepherd kam, ließ ich sie an mit vorbeirauschen. „Mir doch egal“, dachte ich. Hey, ich werde im April 49 und mach’ den Scheiß schon eine ganze Weile, an bestimmten Diskursen muss ich nicht mehr teilnehmen, dazu sind meine Tage einfach zu kurz. Der Promoter jedoch blieb hartnäckig. Ich solle doch mal reinhören. Hab ich gemacht. Und war ganz verzaubert. Mir ist die obige Herleitung wichtig, denn ich bin nicht in der Lage, dieses Album in Shepherds bisherigem Output wirklich zu verorten oder einzuordnen. Ich habe weder „Elaenia“ noch das, was folgte, gegengehört. Auf „Promises“ arbeitet der Brite mit Pharoah Sanders zusammen, dem legendären Saxofonisten, mit dessen Werk ich ebenso wenig vertraut bin. Und das London Symphony Orchestra spielt auch noch mit. Ich finde es toll, wie die beiden hier im Dialog unterwegs sind, vornehmlich sehr minimal und aufmerksam. Natürlich könnte man nun sagen: Mucker trifft Mucker. Aber beide sind ja gar keine, auch wenn vermute, dass Shepherd eigentlich genau da hin will. So bleibt die Musik. Das dockt an nichts an, das steht für sich, ist klar und alles durchdringend strukturiert, baut sich auf, fällt wieder in sich zusammen. Das Orchester hätte es gar nicht gebraucht, schmalzt an den richtigen Stellen aber ganz überzeugend. Ich habe einige Zeit darüber nachgedacht, warum mich diese Platte so anfasst – und schließlich kam ich drauf. Die Grundmotive, sowohl am Synthesizer als auch am Saxofon, sind kaum mehr als eine kluge Adaption von Harold Budds „The Pavilion Of Dreams“, einem meiner absoluten Lieblingsalben. Das mag als Assoziation sehr abstrakt erscheinen, ich höre das aber in jedem Takt.
„Als ich die Album-Ankündigung las, dachte ich: Oh, das wird wohl eine Leistungsschau. Die ist es aber nicht geworden. Im Gegenteil: Man hört die konstruierende Maschine kaum klappern.“
Christian: Wie Thaddi habe ich Floating Points bei seinen früheren House-Produktionen auch immer Muckertum unterstellt. Zugegeben: Mit Muckertum meinte ich eher so etwas wie: Hier macht jemand alles so richtig, dass es total langweilig wird. Aber mit diesem Album hat Shepherd glaube ich ein Format gefunden, in dem sein musikalischer Ansatz viel besser aufgeht als in Verbindung mit Clubmusik. Obwohl offenbar in der Funktion des Masterminds, drängt er sich nicht in den Vordergrund, sondern lässt seinen Mitmusiker*innen sehr viel Raum. Insofern bin ich angenehm überrascht. Sanders gilt ja als großer Expressionist, hält sich dafür aber auch ziemlich zurück. Und das Orchester ebenso. Diese Zurückhaltung aller Beteiligten trägt, glaube ich, zum Gelingen bei. Als ich die Album-Ankündigung las, dachte ich: Oh, das wird wohl eine Leistungsschau. Die ist es aber nicht geworden. Im Gegenteil: Man hört die konstruierende Maschine kaum klappern.
Kristoffer: Wenn ich an Floating Points denke, fällt mir immer sofort ein Interview in der Groove ein, in welchem er seinen Tagesablauf beschrieb. Aus dem Gedächtnis zitiert: Um sieben Uhr aufstehen, einen Tee machen, Toast futtern und Musik hören. Natürlich auf Vinyl. Das ist so ziemlich das Album geworden, das in solchen Momenten wohl laufen muss. Ich bin heute allerdings um halb drei Uhr nachts schweißgebadet mit Bieratem aufgewacht und habe dann erstmal Žižek-Interviews gehört, um wieder einschlafen zu können and so on and so on. Aber natürlich hatte ich auch einen schwachen Moment, als ich am Sonntag aufstand, die To-Do-Liste ausnahmsweise recht leer war und statt drei Deadlines eine gewisse Ruhe im Raum stand. Dann Sanders bei seinen Endlos-Soli zuzuhören: Das passte. Auch weil sich Shepherd tatsächlich sehr zurückhält, ihm eigentlich nur den Raum, ach was, eine Bühne zusammenzimmert, auf den sich der große Jazzer mit ganz kleinen und feinen Tönen ausbreiten kann, als würde er mit ihnen Ballet tanzen. Ich bin ja ein Jazz-Banause, ich mag entweder den ganz klischeehaften Kram – „Kind of Blue“, „Love Supreme“, alles von Alice Coltrane meinetwegen noch – oder alles, was schon Krach ist, Peter Brötzmann oder so. Sanders aber hat durchaus einen festen Platz in meinem Herzen. Und es ist schön, ihm hier so zuzuhören. Ich weiß nur nicht, ob ich mir das nochmal aus dem Schrank ziehen werde wie ich es mit seinem Album „Izipho Zam“ regelmäßig tue. Und was das Orchester da eigentlich soll, checke ich beileibe auch nicht.
Thaddi: Dein Gedächtnisprotokoll des Interviews mit Shepherd spiegelt ja meine Zurückhaltung ihm gegenüber perfekt wider. Ich empfinde praktisch alles, was er bislang vorgelegt hat, als sehr prätentiös. Vielleicht tue ich ihm damit Unrecht, vielleicht treffe ich aber auch ins Schwarze.
Kristoffer: Triffst du, wie ich finde! Also, nicht in Bezug auf seine frühen House-Platten, das war alles zwar irgendwie sehr gefällig, aber es hat gut funktioniert und stach wirklich hervor. Die gewisse – wenngleich extrem bescheidene, was es für mich noch unerträglicher gemacht hat – Muckertumhaltung hat mich allerdings immer genervt. Four Tet hast du als Vergleich genannt, Caribou wäre ein weiterer Kandidat. Für mich sind die drei irgendwann zum Triumvirat des Schreckens geworden. „Elaenia“ war ja eigentlich eine Easy-Listening-Platte, die sich großzügig bei Azymuth bedient hat – transkultureller Prog, so gesehen. Aber Floating Points hat dann doch auch andere und spannendere Sachen gemacht. Zum Beispiel mit Maleem Mahmoud Ghania zu kollaborieren – was übrigens eine biografische Überschneidung hin zu Sanders darstellt, der hat mit dem Gnawa-Meister in den Neunzigern unter Bill Laswells Ohren zusammengearbeitet. Aber egal: Ja, natürlich treibt die Kombination Jazzer plus Club-Produzent plus Orchester das komplett auf die Spitze. Dass es dennoch funktioniert, liegt für mich zumindest daran, dass sich das Endresultat so leicht ignorieren lässt. Musik, die nicht wehtut, weil sie gar nicht so viel will. Auch okay.

Shepherd und Sanders während der Aufnahmen in Los Angeles. Foto: Eric Welles Nystrom
Christian: Obwohl ich mir natürlich Mühe gegeben habe, war dieses Album eigentlich kaum analytisch zu hören. Es saugte mich nicht so sehr in die Musik, ich habe es eher als Einladung zum geistigen Ab- und Umherschweifen empfunden. Es gibt zwar Momente, die ich als strukturgebend erinnere: eine Oboe, das Orchester, das irgendwann so breitbandig reindonnert (was hier für mich tatsächlich super funktioniert hat), oder das Ende, wenn harmonisch alles zerfällt. Aber mir war es fast unmöglich, das im Nachhinein alles zusammenzubekommen oder gar zu einem Urteil zu finden. Ich würde Kristoffer schon zustimmen: Ja, es plätschert, und das hat etwas von Easy Listening. Aber ich finde das hier gar nicht schlimm, weil es wirklich auf sehr hohem Niveau plätschert und es etwas anderes vielleicht gar nicht will und soll. Ich frage mich höchstens, was echte Jazz-Heads dazu sagen. Von Sun Ras Arkestra zum (London Symphony) Orchestra – das ist ja im Werk von Sanders schon ein ziemlicher langer Schritt, no?
Thaddi: Hier zeigt sich wahrscheinlich weniger ein Konflikt der Generationen, als vielmehr einer, der Anspruch und Erwartungen in Bezug auf Musik definiert. Für mich ist das kein Easy Listening, sondern eine sehr präzise Fingerübung – die mich nun – ob meiner oben schon erwähnten Assoziationen – tief berührt bzw. abholt. Dabei bin ich einerseits total bei Kristoffer: mein Triumvirat der Hölle – Floating Points, Four Tet und Caribou. Drei Jungs, die – pardon – immer die Champions sind im Mäntelchen-Drehen. Vollkommen überbewertet. Caribou, ey, ich habe Dan Snaith noch vor 20 Jahren live gesehen. Damals saß er mit einer Schweins-Maske am Schlagzeug. Das ist nun wirklich nicht mein Humor. Und heute ist er plötzlich der Darling des Feuilletons? Dieser Clash zwischen Dancefloor und akzeptierter Hochkultur ist ja ohnehin eines der größten Probleme unserer Zeit. So viele Missverständnisse. Ich bin derweil dankbar, dass es zumindest einem aus diesem Dreigestirn gelungen ist, eine unprätentiöse Platte zu machen – zusammen mit einer Legende. Und wie durch Zufall haben beide die gleiche Sprache gesprochen.
Kristoffer: Ja, aber nein. Ich weiß nicht. Für mich klingt das – auch wenn ich kaum etwas Schlechtes darüber sagen kann und mag – dann doch zu sehr nach der Schallplatte (ist ja wichtig!), die um sieben Uhr morgens bei Darjeeling und Marmeladen-Toast mitläuft. Und nebenbei dann doch eben nach einer großen Anbiederung an hochkulturelle Paradigmen, das sehe ich hier nämlich schon. Um ganz ehrlich zu sein: Das Orchester hätte es hier überhaupt nicht gebraucht! Wenn es zwischendurch kurz in den Mix reingehanszimmert kommt, rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ich glaube, ein großes Sanders-Solo mit ein bisschen Floatie-Chords unten drunter hätte mir wesentlich mehr behagt. Auch weil die Geste dann der Musik entsprechend bescheidener auf mich gewirkt hätte.
Thaddi: Ja, das Orchester hätte es nicht gebraucht. Zum Glück hat es für mich nicht diese zerstörerische Wirkmacht. Will sagen: Fußnägel noch alle da. Zum Glück – das wäre jetzt auch ein bisschen zu blutig geworden. Wenn wir uns dann Ende 2022 endlich wieder zu dritt an den Küchentisch setzen können, ist eh alles vergessen.