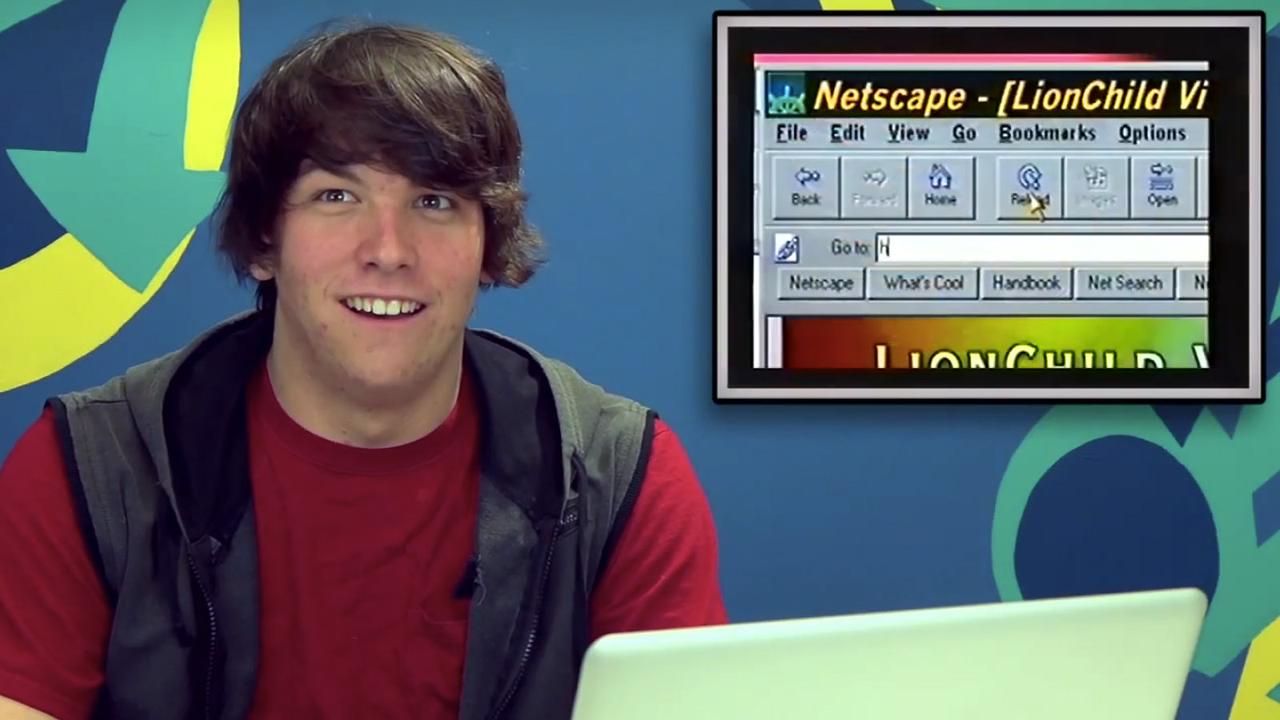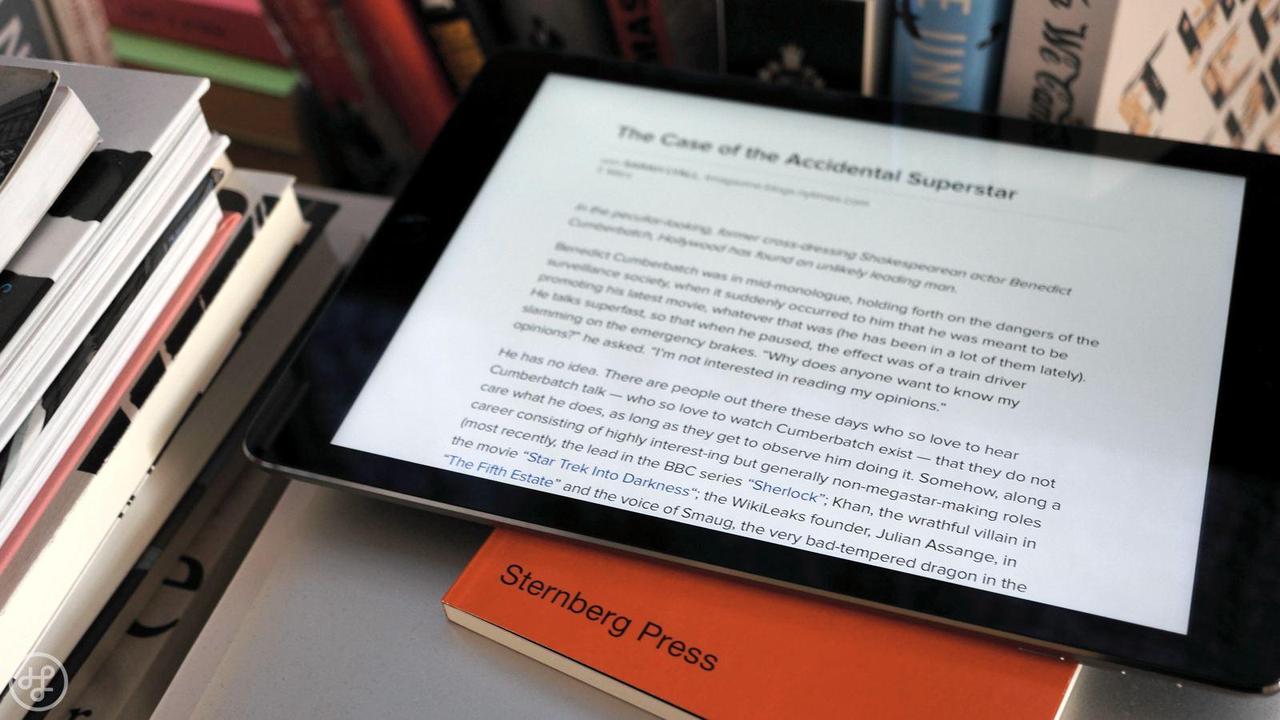Hintergrund: Warum YouTube mit Indie-Labels streitetFair Trade für Musikvideos
5.6.2014 • Internet – Text & Interview: Thaddeus Herrmann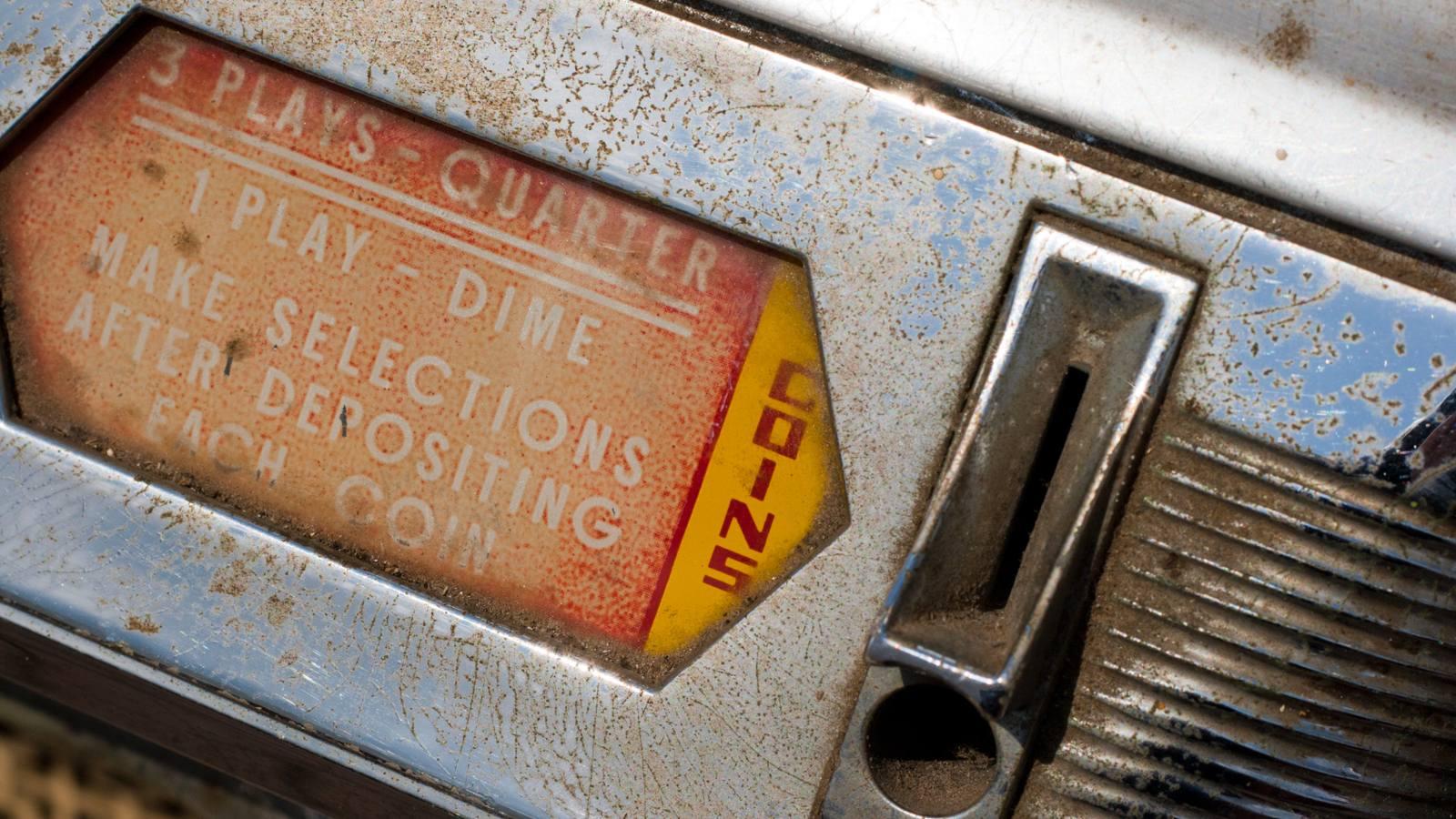
Bild: Vintage jukebox coin input via Shutterstock
Google spielt im digitalen Musikgeschäft aktuell eine eher untergeordnete Rolle. Besitzt aber dank YouTube nicht nur umfangreiche Inhalte, sondern verfügt auch über blendende Nutzerzahlen. Ein kostenpflichtiges Abo-Modell für das Video-Portal soll jetzt Geld in die Kassen spülen. Die Indie-Labels schlagen Alarm.
Google will ein Stück vom Streaming-Kuchen. Und plant gleich zwei entsprechende Dienste, die miteinander in Konkurrenz stehen könnten. Das erste Streaming-Angebot soll im hauseigenen Play Store aufgesetzt werden. Dort kann man schon seit längerem Musik kaufen, ganz klassisch eben. Zukünftig soll Streaming à la Spotify oder Rdio ebenfalls Teil des Angebots sein.
Der zweite Streaming-Dienst, den Google aufsetzen will, ist schon ungewöhnlicher. Das Video-Portal YouTube soll zukünftig ebenfalls mit einem kostenpflichtigen Abo-Modell ausgestattet werden. So könnte man sich Musikvideos endlich werbefrei anschauen. Und gleichzeitig auch die User erreichen, die kein Android-Gerät haben und den Play Store nicht nutzen können oder wollen.
YouTubes schier unvorstellbare Zugriffszahlen werden von Google aktuell durch Werbung finanziell vergoldet. Das Portal ist eines der letzten Beispiele für die vermeintliche Umsonst-Kultur des Internet. Aber, und das wissen wir in Deutschland ganz besonders gut, wenn es um urheberrechtlich geschütztes Material geht, ist dieser Traum schon lange ausgeträumt. Googles Algorithmen durchsuchen kontinuierlich neu hochgeladene Videos. Ergibt diese Suche ein Problem, gehen die Videos gar nicht erst online. Ein bekanntes Problem.
Weniger bekannt hingegen ist die Tatsache, dass Google die Rechteinhaber schon jetzt an den Werbeeinnahmen beteiligt. Gerade in Deutschland versendet sich das in der zunehmenden Flut der allseits gehassten Sperrhinweise. Diese Umsatzbeteiligung muss jedoch von den Rechteinhabern proaktiv eingefordert und angegangen werden.
Nun will Google offenbar ein für alle Parteien leichter zu durchschauendes Abo-Modell einführen. Doch es gibt Widerstand. Die Lobby-Verbände der Indie-Labels schlagen Alarm. Google sei sich mit den großen Plattenfirmen bereits einig, die Verträge angeblich in trockenen Tüchern. Die Konditionen, mit Google die kleineren Labels anbiete, seien, so der Tenor der Interessensverbände, im Vergleich jedoch deutlich schlechter und somit inakzeptabel. Ein Vorwurf, den sich auch Spotify auch immer wieder anhören muss. Noch schlimmer allerdings: Google setzt den kleinen Labels die Pistole auf die Brust und droht mit der kategorischen, weltweiten Sperre aller entsprechenden Inhalte, wenn der Vertrag nicht unterschrieben werde.
Handfeste Beweise gibt es dafür nicht. Google selbst äußert sich nicht, die Labels, die Musterverträge bereits vorliegen haben, geben keine Details an die Öffentlichkeit. Google selbst jedoch ist unter Zeitdruck. Am 25. Juni beginnt die Entwicklerkonferenz I/O, die eine perfekte Gelegenheit wäre, den neuen Service zu präsentieren.
##Ausgang ungewiss
Es ist also eine hoch komplexe und komplizierte Gemengelage. Was auch der offenen Struktur von YouTube geschuldet ist. Da gibt es User, die einfach ihre Lieblingsmusik hochladen. Um ihre Urlaubsvideos zu untermalen, oder das Bewegtbild-Tagebuch ihrer Katze. Dann gibt es die Labels und ihre offiziellen Kanäle mit den „echten“ Musikvideos: Promo-Tool und Service für die Fans. Und oft noch die Musiker selbst mit ihren eigenen Uploads. Welche Videos nun tatsächlich von Google im Fall des Falles gesperrt werden würden, ist vollkommen unklar. Klar ist hingegen, dass YouTubes Herangehensweise, unterschiedlich große Labels mit zweierlei Maß messen und vergüten zu wollen, ein Problem ist. Geld mit Streaming-Angeboten zu verdienen, ist aufwendig, sehr kleinteilig und vor allem unberechenbar.
Wir nehmen den schwelenden Rechtsstreit zwischen Google und den Indies zum Anlass, um uns den aktuellen Status Quo erklären zu lassen. Jens Alder kümmert sich beim Berliner Label Morr Music um den Digitalvertrieb, also auch um die YouTube-Gelder. Nicht nur für das Repertoire des eigenen Katalogs, sondern treuhänderisch auch um den vieler anderer Labels.

Bild: Coin Slot via Shutterstock
Wie können Labels aktuell die Verwertung ihrer Inhalte auf YouTube monetarisieren, sprich: Wie werden von Usern hochgeladene Videos vergütet?
Jens Alder: YouTube unterscheidet drei verschiedene Assets, also Komponenten, die zusammen ein Video ausmachen. Theoretisch vergütet YouTube alle Assets. Wie dabei der Split ausfällt, ist mir nicht bekannt. Da ist zunächst das Video Asset, also der visuelle Teil. Dann das Audio Asset. Das ist vergleichbar mit den Master-Rechten, also den Rechten, die normalerweise die Plattenfirma verwaltet. Schließlich gibt es noch das Composition Asset, vergleichbar mit dem Urheberrecht. Ein Video kann mehrere Audio- und Composition Assets* enthalten.
Das Video Asset wird vom Uploader ausgewertet, also von der Partei, die das Video hochlädt. Das Audio Asset wird im Auftrag der Labels von Digitaldienstleistern ausgewertet, wie z.B. von uns bei Morr Music. Kernstück hierbei ist YouTubes „Audio Fingerprinting“-Algorithmus. Wie geht das? Die Digitaldienstleister laden MP3s in YouTubes Backend. Ein Server berechnet die Audio Fingerprints, durchsucht alle Videos nach diesen Fingerprints und stellt so fest, unter welchem Katzenvideo welcher Lady-Gaga-Titel liegt. Technisch ist das der totale Wahnsinn. Da werden 30 Sekunden lange Sequenzen von 10-minütigen Tracks in stundenlangen Videos gefunden und dokumentiert.
Prinzipiell kann der Rechteinhaber des Audio Assets Richtlinien bezüglich der Verwertung steuern, also festlegen, in welchen Territorien wie monetarisiert wird, sprich Geld eingesammelt werden soll. Faktisch jedoch setzt sich YouTube über diese Richtlinien hinweg. So wird zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht monetarisiert. Solange sich YouTube und die Gema nicht einigen, bezahlt YouTube auch die Inhaber der Masterrechte nicht. Quite dreist. Der Inhaber des Master-Rechte muss YouTube mitteilen, welche Kompositionen überhaupt online und welche Komponisten, Autoren und Verlage beteiligt sind.
„Auch für die Musikindustrie kann Streaming ein Segen sein. Monatlich zehn Euro für Spotify Premium machen unter dem Strich doch mehr als zwei CDs zu 19,99 im Weihnachtsgeschäft.“
Von was für Beträgen sprechen wir da überhaupt, wenn YouTube Gelder für Videoplays auszahlt?
Jens Alder: Das lässt sich allgemeingültig tatsächlich schwer beziffern. Bei Morr Music haben wird für den Katalog, den wir betreuen, für den April 2014 einen Mittelwert von 0,0005 US-Dollar errechnet. Nun werden die einzelnen Aufrufe aber sehr unterschiedlich vergütet. Da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Wie viele Rechteinhaber sind beteiligt, wie sind die Richtlinien und so weiter. Um diese Summe einordnen zu können, habe ich mir mal die Umsätze angesehen, die ein „klassischer“ Stream generiert. Darunter verstehe ich eine einfache und klar definierte Rechteverteilung: das Albumcover als Video Asset, der Track als Audio Asset. Da gab es für 200.000 Aufrufe ca. 200 Dollar, also 0,001 Dollar pro Aufruf.
Lässt sich dieses Vergütungsmodell überhaupt mit Audio-Streaming-Angeboten vergleichen?
Jens Alder: Wenn man sich auf die „klassischen YouTube-Streams" beschränkt, geht das so halbwegs. Dann ist ein Aufruf mit einem Spotify-Stream vergleichbar.
Alles, was darüber hinaus geht, wird sehr schnell sehr komplex: mehrere Audio- und Composition-Assets, verschiedene Verwertungsrichtlinien, territoriale Einschränkungen. Streaming ist sowieso sehr kompliziert. Denn die Einkommensgenerierung fußt im Gegensatz zu Downloads bei iTunes und Co., die ja eindeutige Preise haben, bei Streaming-Anbietern auf zwei schlecht kalkulierbaren Komponenten: Werbeeinnahmen und Aboeinnahmen. Die genaue Höhe der Einnahmen variiert von Abrechnungszeitraum zu Abrechnungszeitraum. Dazu kommt, dass die Anzahl der Abrufe ebenfalls variiert. Dementsprechend schwankt die Summe, die pro Stream erzielt wird. Bei rein werbefinanzierten Portalen wie YouTube kann man dann zum Beispiel im Januar nur 25% der Dezemberumsätze erzielen.
Um die Sache zusätzlich zu verkomplizieren, kommen Kooperationen der Streaming-Anbieter hinzu. Mit Mobilfunkern zum Beispiel, aber auch sonstige Bonus-Programme und natürlich territoriale Besonderheiten. Aber um die Frage zu beantworten: Wir rechnen bei Spotify mit 0,005 Dollar pro Stream, bei YouTube aktuell mit 0,0005 Dollar.
„Wir rechnen bei Spotify mit 0,005 Dollar pro Stream, bei YouTube aktuell mit 0,0005 Dollar.“
Wie wichtig ist das Streaming mittlerweile als Geschäftmodell? Aus deiner Erfahrung: Wie haben sich die erzielten Einnahmen zwischen bezahlten Downloads und Streaming mittlerweile verschoben? Ist da ein Trend zu erkennen?
Jens Alder: Der Trend ist deutlich zu sehen. Die Umsätze, die mit Downloads erzielt werden, sind rückläufig. Seit Februar 2014 ist Spotify bei uns der umsatzstärkste Partner. Streaming ist aus meiner Sicht das Geschäftsmodell der Zukunft, zumindest was Musiknutzung angeht. Very user friendly. Low cost, low maintenance. Allerdings auch leider low quality. Auch für die Musikindustrie kann Streaming ein Segen sein. Monatlich zehn Euro für Spotify Premium machen unter dem Strich doch mehr als zwei CDs zu 19,99 im Weihnachtsgeschäft.
Die jetzt angefachte Diskussion erinnert mich an die Zeiten, in denen Labelverbände die Vergütung von iTunes kritisierten und auch an die Zeit, in der die Streaming-Verträge mit Spotify etc. ausgehandelt wurden. Letztendlich haben sich aber doch die meisten Labels gefügt und mitgemacht. Was ist jetzt im Falle von Google anders?
Jens Alder: Soweit ich das verstehe, geht es momentan darum, dass YouTube einen Abodienst einrichten will. Was dieser Dienst dann genau kann, und inwiefern die oben beschriebene Monetarisierung davon berührt wird, ist mir nicht bekannt.
Vielleicht wird auf YouTube parallel zu Google Play ein reines Music-Streaming-Abo gestartet. Das würde aus Googles Sicht Sinn machen. Google Play interessiert wahrscheinlich nicht mal alle Nutzer von Google+, während bei YouTube traumhafte Nutzerzahlen anfallen und Google ziemlich genau weiß, was die in den letzten neun Jahren alles gehört haben.
Ich vermute, die aktuelle Aufregung ist zwei Gründen geschuldet: Zum einen hat YouTube offensichtlich zwei Arten von Verträgen. Einen besser vergüteten für die Major Labels und einen schlechter vergüteten für die Indies. YouTube hat diesen Vertrag einigen Indies zukommen lassen, die wollen den aber nicht unterschreiben. Zum anderen steht hinter YouTube eben nicht irgendwer, sondern Google. So ein Vertrag könnte also enorme Folgen haben. Hier war Apple schlauer. Anstatt als Marktführer einen Streaming-Deal zu verhandeln, haben sie Beats samt sauber unterzeichneten Verträgen gekauft. Knackpunkt des Vertragsentwurfs ist die Drohung, dass YouTube im Falle der Nichtunterzeichnung jegliche Inhalte sperren wird. Was das jedoch konkret bedeuten könnte, ist ebenfalls vollkommen unklar.
Wichtig zu erwähnen ist, dass die Indie-Label sich nicht gegen die aktuellen Tarife von YouTube wehren. Die sind seit zwei Jahren aktuell und funktionieren.
Damit würde sich Google doch auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn über Nacht zigtausende Videos gesperrt würden.
Jens Alder: Zumindest würde der Slogan „Don't Be Evil“ arg strapaziert.
Die eigentliche Frage ist, was es konkret bedeutet, Inhalte zu sperren. Würde YouTube wirklich jeglichen „User Generated Content“ sperren, also Katzenvideos, die mit Indie-Repertoire unterlegt sind, würden vermutlich mehr als 30% aller Videos offline gehen. Ich vermute eher, dass YouTube hier die Taktik anwendet, die auch im Streit mit der Gema verwendet wird. Da werden ausgewählte klickstarke Musikvideos von Indie-Acts gesperrt und ein paar irreführende Informationen gestreut. Alles in der (leider nicht unbegründeten) Hoffnung, die Künstler gegen ihre Labels aufzubringen. Wenn den Arctic Monkeys plötzlich 10.000.000 Klicks fehlen, ist egal, ob dafür 5.000 US-Dollar beim Label ankommen oder nicht.
Aufgrund der Lizenzierungs-Differenzen zwischen Google und den Verwertungsgesellschaften schwenken immer mehr Labels auf andere Kanäle wie z.B. Vimeo um oder fahren zweigleisig. Nicht ohne Folgen: Vimeo ist dabei, ein Erkennungssystem zu integrieren, um so ebenfalls bestimmte Inhalte sperren zu können. Lassen sich aktuell aus Label-Sicht auch schon Views auf Plattformen wie Vimeo monetarisieren?
Jens Alder: Als Ausweichportal und „Technikdienstleister“ mag es dem einen oder anderen dieser Tage attraktiv erscheinen. Doch soweit ich weiß, vergütet Vimeo die Masterrechte nicht. Insofern gibt es da auch erstmal nichts zu sperren. Und eigentlich gibt es auch keinen Grund, zu Vimeo zu wechseln. 0,0000 Dollar pro Stream sind noch weniger als 0,0005.