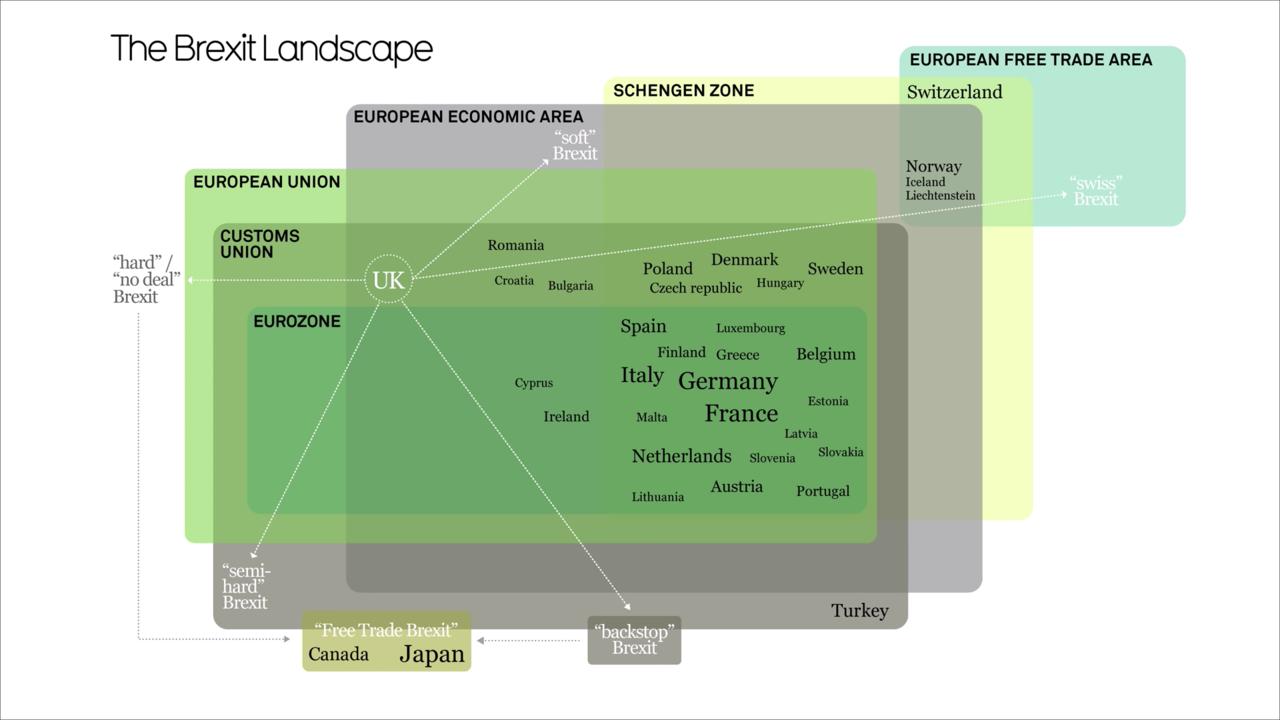„Alkohol spielt lange die Rolle des unauffälligen Begleiters“Interview: Eva Lia Reinegger über ihre Hörspielserie „Immer dienstags“
8.5.2019 • Gesellschaft – Interview: Jan-Peter Wulf
Die Bloggerin Diana, der Ex-Tenniscrack Jeff, der polnische Physiotherapeut Tomasz, der Obdachlose Pütz – sie alle haben etwas gemeinsam: Sie trinken zu viel. Oder vielmehr tranken. Sie sind seit Kurzem oder schon länger trockene Alkoholiker und treffen sich in einer Selbsthilfegruppe in einem Gemeindezentrum in Berlin-Moabit, einmal pro Woche. Dort sprechen sie über ihre Probleme, ihre Sorgen, ihren Alltag. In Letzteren nimmt uns das Hörspiel „Immer dienstags“ mit: Wir erfahren, wie es dazu kam, dass Jeff von der Tennishoffnung zum Trinker wurde, warum Tomasz frustriert fast wieder zum Glas greift und dass Diana eigentlich einen Star-Regisseur treffen will, stattdessen aber an der Supermarkt-Kasse gewalttätig wird. „Immer dienstags“ hat die Berliner Drehbuchautorin Eva Lia Reinegger für den WDR geschrieben. Ein aufwendig produzierter Vierteiler, dem bekannte Schauspieler wie Winfried Glatzeder, Judith Engel und Fritzi Haberlandt ihre Stimmen leihen. Jan-Peter Wulf traf die Autorin zum Gespräch über die Entstehung der Story und darüber, wie das „Hörspiel-Business“ eigentlich funktioniert.
Eva, dein wievieltes Hörspiel ist „Immer dienstags“?
Produziert habe ich insgesamt fünf. Ein sechstes Hörspiel für Kinder ist gerade in der Pipeline: „Crazy Santa“, ein Weihnachtshörspiel für Weihnachten 2020, für den SWR in Zusammenarbeit mit dem Hörverlag. Ich habe vorher drei Krimis gemacht und eine Adaption eines norwegischen Kinderbuchs.
Wie hast du damit angefangen?
Ich bin ja eigentlich Drehbuchautorin und hatte immer wieder mit Stoffen zu tun, die in der Schublade herumlagen. Stoffe, bei denen ich schade fand, dass sie nicht produziert wurden. Bei einem habe ich gedacht: Der würde sich echt gut fürs Radio eignen. Ich habe ihn komplett zum Manuskript – so nennt man das Drehbuch beim Radio – ausgeschrieben, auf 50 Minuten, das ist die klassische Hörspiellänge. Das war „Tod eines Fußballers“. Das Manuskript habe ich dann an verschiedene Redaktionen geschickt, und dann ging es total schnell. Produziert wurde es dann vom WDR.
Ist das immer so, dass du ein komplettes Manuskript anbietest? Oder mit welchem Fertigungsgrad „pitchst“ du?
Ein komplettes Manuskript hatte ich nur beim ersten Mal. Bei „Immer dienstags“ zum Beispiel hatte ich ein relativ ausführliches Exposé, in dem die Figuren schon dargelegt waren, die Plots, die Struktur. Ursprünglich hatte ich es auf sechs Folgen und sechs Figuren angelegt. Das habe ich dem WDR vorgeschlagen, und als sie sagten, dass es sie interessiere, habe ich es komplett ausgeschrieben. Im Manuskript stehen das sämtliche Dialoge drin sowie kleine Regieanweisungen, gestaltende Elemente. Es ist wie ein kompletter Ablaufplan für die Umsetzung.
Wie umfangreich ist so ein Manuskript?
Es sind knapp 120 Seiten für vier Folgen à 30 Minuten. Das ist eine ungefähre Marke: Eine Drehbuch- oder Manuskriptseite entspricht einer Minute.
Und wie läuft das mit der Bezahlung? Wann kommt das Geld?
Den Vertrag und auch die Bezahlung gibt es erst ganz am Ende. Weswegen man die Unsicherheit hat, ob man wirklich zusammen kommt. In diesem Fall war es aber so, dass der WDR mir einen Dramaturgen an die Seite gestellt hat, Gerrit Booms, mit dem ich sehr gut arbeiten konnte. Und so gab es von Anfang an seitens des Senders ein Commitment.
Hast du darüber hinaus auch mit den Leuten zu tun, die dein Hörspiel umsetzen?
Wenn das Manuskript fertig und von der Redaktion abgenommen ist, habe ich mit dem gesamten Herstellungsprozess nichts mehr zu tun.
Wow.
Die Redaktion setzt Regisseure drauf, entscheidet, wer gecastet wird, dann kommt die Inszenierung rein. Das hat schon eine eigene starke Farbe – zum Beispiel wie ausführlich der Sound ist, welche Musik genommen wird.
Und wie gefällt dir das Ergebnis bei „Immer dienstags“?
Ich finde, die Inszenierung ist gelungen. Auch das Casting ist toll – bei dieser Produktion war es eine runde Sache für mich. Aber natürlich hat man beim Schreiben des Manuskripts bestimmte Vorstellungen, die man auch anlegt, und dann entscheidet sich die Regie anders. Die Stimme klingt anders als gedacht, die Figur wirkt jünger, als man sich das vorgestellt hat, spielt anders. Aber insgesamt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Es geht um Alkoholismus und Selbsthilfegruppen. Wie kamst du darauf?
Ein Stück weit hat es einen persönlichen Bezug. Zwei Freundinnen von mir hatten Mütter, die Alkoholikerinnen waren. Ich habe viel von der Problematik mitbekommen. Und allgemein finde ich, dass Sucht ein interessantes Thema ist. Sie ist verbreitet, wir bekommen alle ein bisschen davon mit, wenngleich nicht in dieser starken Ausprägung und Symptomatik.
Die feucht-fröhliche Party-Szenerie in der ersten Folge, in so einer Situation werden sich vermutlich einige Hörer wiederfinden.
Man hat ja oft dieses Klischee im Kopf – mit Alkoholikern hat man nichts zu tun, das sind vielleicht Obdachlose, die auf der Straße leben. Darum war es mir wichtig, eine Bandbreite an Figuren zu erzählen aus unterschiedlichen Milieus, um zu zeigen: Das kann uns alle treffen. Deswegen kommt auch jemand Junges vor, eine eloquente Frau, die über Gin reden kann in einer Partysituation, die wir alle kennen …
… ja, die Gin-Gespräche! Wie hast du recherchiert? Es hat ja, finde ich, einen „reportagigen“ Charakter, hintergründig.
Ich habe mir dieses Projekt erstmal komplett ausgedacht: sechs Figuren und ihre Geschichten. Selbsthilfegruppen deshalb, weil ich das Format interessant finde. Im Grunde ist es ein therapeutisches Sprechen in einer Gruppe, die sich immer wieder völlig neu zusammenwürfelt. Das fand ich als Ort und als Methode spannend. Erst, als der WDR zusagte, bin ich in die Recherche gegangen. Ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die lange auf einer Suchtstation gearbeitet hat, habe Selbsthilfegruppen besucht, sehr unterschiedliche, um zu sehen, wie sind da die Abläufe? Das mache ich gerne so: Erst denke ich mir etwas aus, dann gehe ich raus und gucke – stimmt das? Aus der Recherche heraus habe ich an den Figuren und ihren Geschichten nichts verändert. Aber ich habe Details aufgegriffen, um die Geschichten anzureichern.
Zum Beispiel?
Kleinigkeiten wie die Kaffeekasse. Oder der klassische Spruch am Anfang: Man sagt seinen Namen und „ich bin Alkoholiker“. Den gibt es tatsächlich so.
Hast du dich als recherchierende Journalistin vorgestellt?
Unterschiedlich. Zu Anfang habe ich den Leiter einer Selbsthilfegruppe interviewt und gefragt, ob ich mitkommen darf, seine Gruppe hat zugestimmt. Bei anderen Meetings hat mich jemand mitgenommen. In den Meetings muss man sich ja nicht vorstellen. Ob du sprichst, ist dir freigestellt. Oft kommen Freunde und Angehörige mit.
Wie waren die Meetings, die du besucht hast?
Auch völlig unterschiedlich. Es gibt große mit 40 Leuten, dialogische mit Rücksprachen und monologische mit einem Redebeitrag nach dem anderen, mit nur sanfter Moderation.
Was war dein Eindruck: Sind diese Treffen hilfreich für die Betroffenen?
Sehr. Viele Leute, das war mein Gefühl, brauchen das richtig. Es ist ein ganz wichtiges Element in ihrem Leben, es gibt Halt. Es mag sein, dass man sich immer mal phasenweise was Neues sucht, weniger zu den Treffen hingeht. Aber ich habe es schon so wahrgenommen, dass es sehr stabilisiert.
Sind die Menschen, die du dort getroffen hast, so divers wie die Figuren in „Immer dienstags“?
Absolut. Sie kommen aus unterschiedlichsten Milieus, Berufen und Vierteln. Und ich war erstaunt, wie viele junge Leute kommen. In Berlin gibt es wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen für Alkoholiker, und diese sind schon vom Ansatz her sehr divers: Es gibt solche für Menschen aus Polen, es gibt persische Gruppen, oder Treffen nur für Alkoholikerinnen. Manche treffen sich morgens um zehn, andere mitten in der Nacht.
Verfolgst du mit dem Thema eine Absicht?
Also, es ging mir überhaupt nicht darum zu sagen: Achtung, Achtung! Mir war es auch wichtig, nicht ständig nur um den Alkohol zu kreisen, werden die jetzt rückfällig oder nicht? Das würde zu kurz greifen. Sondern zu zeigen: Das sind Menschen, die sich mit Problemen rumschlagen, die wir alle kennen – beruflicher Stress, Beziehungskrisen, die Belastung durch die Pflege eines Angehörigen. Das ganz normale Drama des Lebens sozusagen. Alkohol spielt lange die Rolle des unauffälligen Begleiters. Durch ihn drückt sich der Druck aus. Die Sucht läuft mit und kippt dann um, schlägt zu und bringt die Leben ins eigentliche Drama. Was alles andere als lapidar, sondern tragisch und dramatisch für die Leute und ihre Angehörigen ist, wenn es soweit ist. Dann wird man die Sucht nicht mehr los, sie wird zerstörerisch. Das will ich schon auch sagen, weil man das bei uns vielleicht wenig realisiert: Alkohol ist eine Droge. Alkoholismus, das habe ich bei meiner Recherche erlebt, ist ein riesiges, weit verbreitetes Krankheitsbild. Und man rutscht leicht in ihn hinein.
Woran merkt man, dass man hineinrutscht?
Aus medizinischer Perspektive gibt es klare, abfragbare Kriterien. Mein Eindruck ist: Wenn man bei sich selbst das Gefühl hat, da entsteht gerade wie so etwas wie eine Sucht, dann sollte man ruhig genauer hinschauen.
Woran arbeitest du gerade?
An einem Podcast-Projekt: „Ich bin 13“. Dabei soll es darum gehen, 13-jährige aus verschiedenen europäischen Städten zu besuchen und einen Tag lang zu begleiten.
Vielen Dank, Eva.