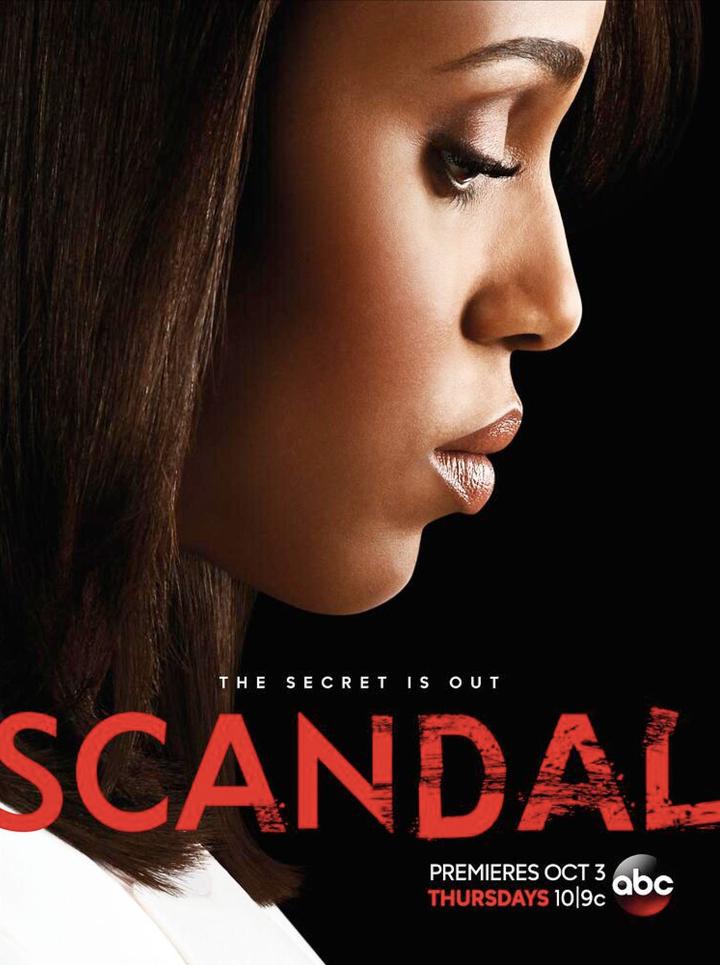Politisch kontrovers statt zynisch resigniertWarum Scandal besser ist als House of Cards
30.5.2014 • Film – Text: Rabea Tanneberger
Foto: Netflix
Acht Jahre nach dem Ende von „The West Wing“ wird das Weiße Haus wieder zum Spielort amerikanischer Fernsehserien. Warum die Politik-Soap „Scandal“ dabei besser abschneidet als David Finchers aalglattes Intrigenspiel „House of Cards“, analysiert Das Filter-Autorin Rabea Tanneberger.
Die hollywoodianische Drehbuchschule empfiehlt, in die Exposition eines jeden Films eine „Save the cat“-Szene einzuflechten – die Szene, in welcher der Protagonist eine (metaphorische) Katze rettet und sich damit einen Platz im Herzen der Zuschauer sichert.
Dieses einfache Konzept der Empathieerzeugung virtuos verkehrend, gibt bereits die erste Szene der Netflix-Serie „House of Cards“ Aufschluss über die Kontroverse, die ihr Serienheld in uns auslösen soll: Frank Underwood (Kevin Spacey), Fraktionsführer der Demokratischen Partei, stranguliert mit bloßen Händen einen angefahrenen Welpen. Während die Leidensgeräusche aus dem Off langsam verstummen, sinniert Underwood dem Zuschauer zugewandt: „There are two kinds of pain. The sort of pain that makes you strong and the useless pain, that’s only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act, do the unpleasant thing, the necessary thing.“
Diese brutale Inversion der „Save the cat“-Szene gibt bereits Aufschluss über den souverän-patriarchalischen Führungsstil Franks. Vor allem aber darüber, dass Underwood weder Held noch Antiheld ist: Er ist der Bösewicht in „House of Cards“.

Foto: Netflix
Eine ungewöhnliche Ausgangssituation, die sich in zehn einstündigen Folgen zu einem elegant komponierten Intrigenspiel entwickelt: In manipulativer Selbstherrlichkeit spinnt Frank Underwood die Fäden für seinen Aufstieg zum US-Präsidenten. Auch seine persönlichen Beziehungen scheinen dabei Teil eines größeren Plans zu sein: Sowohl Ehefrau Claire (Robin Wright), die mit stählerner Eleganz eine Wohltätigkeitsorganisation leitet, als auch Journalistin Zoe Barnes (Kate Mara) fungieren weniger als „love interests“ denn als seine Schachfiguren im Spiel um das Oval Office. Underwoods manipulatives Spiel macht auch vor dem Zuschauer nicht halt: Der Bruch der vierten Wand, der zum wiederkehrenden Mittel wird, die wahren Intentionen hinter Underwoods geschliffener Rhetorik offenzulegen, entpuppt sich nur als ein weiterer seiner Tricks. Seine Gedanken und Gefühle bleiben ebenso im Dunkeln wie der Ursprung seines unstillbaren Machthungers.
Das Kunststück, dem Zuschauer Sympathie für einen selbstgerechten, skrupellosen Politiker zu entlocken, erschöpft sich so spätestens zu Beginn der zweiten Staffel, wenn (Spoiler Alert!) Underwoods einzige ebenbürtige Antagonistin Zoe von der Bildfläche verschwindet. Mit fortschreitender Länge verliert auch die glatte Politkulisse deutlich an Faszination. Dem Namen ihres Produzenten David Finchers scheint die Serie in ihren lichtarmen, mit schwerer Symbolik aufgeladenen Bildern, ein bisschen zu krampfhaft gerecht werden zu wollen.
Langweiliger als ein Held, der immer gewinnt, ist nur ein Bösewicht, der immer gewinnt.
Die fehlende (Zwischen-)Menschlichkeit, die sich spontan und ohne Hintergedanken ergibt, sowie Franks eiserne Unantastbarkeit entzieht „House of Cards“ so zunehmend seine erzählerische Brisanz. Denn langweiliger als ein Held, der immer gewinnt, ist nur ein Bösewicht, der immer gewinnt. Dementsprechend gehört auch die vielleicht einzige zärtliche Geste, die „House of Cards“ ihren Zuschauern gewährt, zu den besten Szenen der Serie: Das geheime nächtliche Rauchen von Frank und Claire am Fenster ihrer majestätischen Villa. Doch auch dieser Moment ungestörter Zweisamkeit kann die Zweifel nicht zerstreuen, dass auch Frank und Claire den anderen im Haifischbecken von Washington DC ohne Zögern zerfleischen würden, wenn die Umstände es verlangten.
##Große Gefühle in rauen Mengen
In „Scandal“, der neuen Serie von Arzt-Soap-Autorin Shonda Rhimes („Grey’s Anatomy“, „Private Practice“), sind große Gefühle – nicht wirklich überraschend – in rauen Mengen vorhanden. Fast spiegelbildlich zu „House of Cards“ versucht US-Präsident Grant in „Scandal“ vergeblich, seine Macht abzugeben, damit er seine Ehefrau verlassen und ein Leben mit seiner ehemaligen Wahlkampfleiterin und großen Liebe Olivia Pope beginnen kann. Unpraktischerweise ist es die Profession von Serien-Protagonistin Olivia (Kerry Washington), die Skandale der Politik- und Geschäftswelt rund um das Weiße Haus zu verhindern und zu vertuschen.

Foto: ABC
Weniger fiktionalisierte Monica Lewinsky als vielmehr ein weibliches Equivalent des Problemlösers „Mr. Wolf“ in „Pulp Fiction“, operiert Olivia in „Scandal“ dabei fast ebenso rücksichts- und skrupellos wie Frank Underwood in „House of Cards“: Ohne mit der Wimper zu zucken, vergibt sie Auftragsmorde, manipuliert Feinde und Freunde gleichermaßen und nimmt keine Rücksicht auf Verluste zur Durchsetzung ihrer Interessen. Die Liebesgeschichte zwischen dem idealistisch-kindlichen Präsidenten und der kompromisslosen Powerfrau ist dabei ebenso grotesk wie charmant, in jedem Falle aber erfrischender als die Fabel des korrupten Patriarchen, der allein auf seinen eigenen Vorteil aus ist.
Anstatt sich zynisch-resigniert an der Korruption weißer Upperclass-Protagonisten zu amüsieren, greift „Scandal“ einige der aktuellen Kontroversen amerikanischer Politik auf.
In der ersten Staffel, die mit sieben Folgen eher wie ein überlanger Pilotfilm wirkt, narrativ noch etwas bieder und zuweilen kritisch am Rande des Pathos, entwickelt sich die Serie mit der zweiten Staffel zu einem Must-see unter den aktuellen Dramaserien. Dicht geschrieben, mit intelligenten Twists und einem aggressiven Sounddesign versehen, in dem das repetitive Geräusch auslösender Kameras die omnipräsente Überwachung durch Staat und Medien suggeriert, wird „Scandal“ nie langatmig.
Nicht zuletzt ist es die Entourage von Olivia und Grant, von dem traumatisierten Ex-CIA-Killer Huck Finn über Grants ambitionierte Südstaaten-Ehefrau Mellie bis hin zu seinem kaltblütigen Stabschef und dessen babybesessenen Ehemann, die „Scandal“ sehenswert macht. Mehr noch: Die Serie, die neben den stillen Kompositionen von „House of Cards“ zunächst wie seichter Pop wirken mag, wagt sich dabei an Themen, die von tatsächlicher politischer Relevanz sind. Anstatt sich zynisch-resigniert an der Korruption weißer Upperclass-Protagonisten zu amüsieren, greift „Scandal“ einige der aktuellen Kontroversen amerikanischer Politik auf: von inszeniertem Terrorismus über Lochgefängnisse und „Waterboarding“ als legitime Verhörmethode bis hin zur Allmacht der staatlichen Überwachungssysteme. So ist letztlich nicht die Affäre des US-Präsidenten der wahre „Scandal“, sondern die brachiale Ambivalenz einer Politmaschinierie: In ihrer dramatischen Überzeichnung ist sie vielleicht gar nicht so wirklichkeitsfern, wie es zunächst scheint.