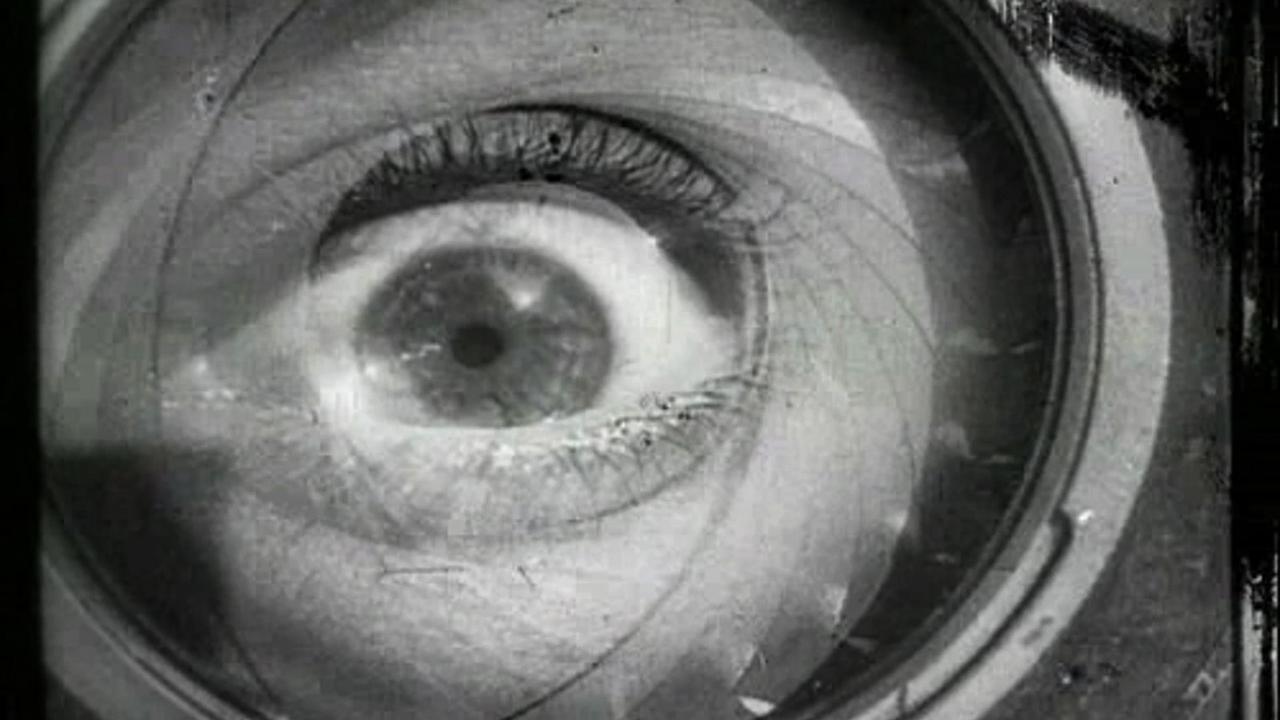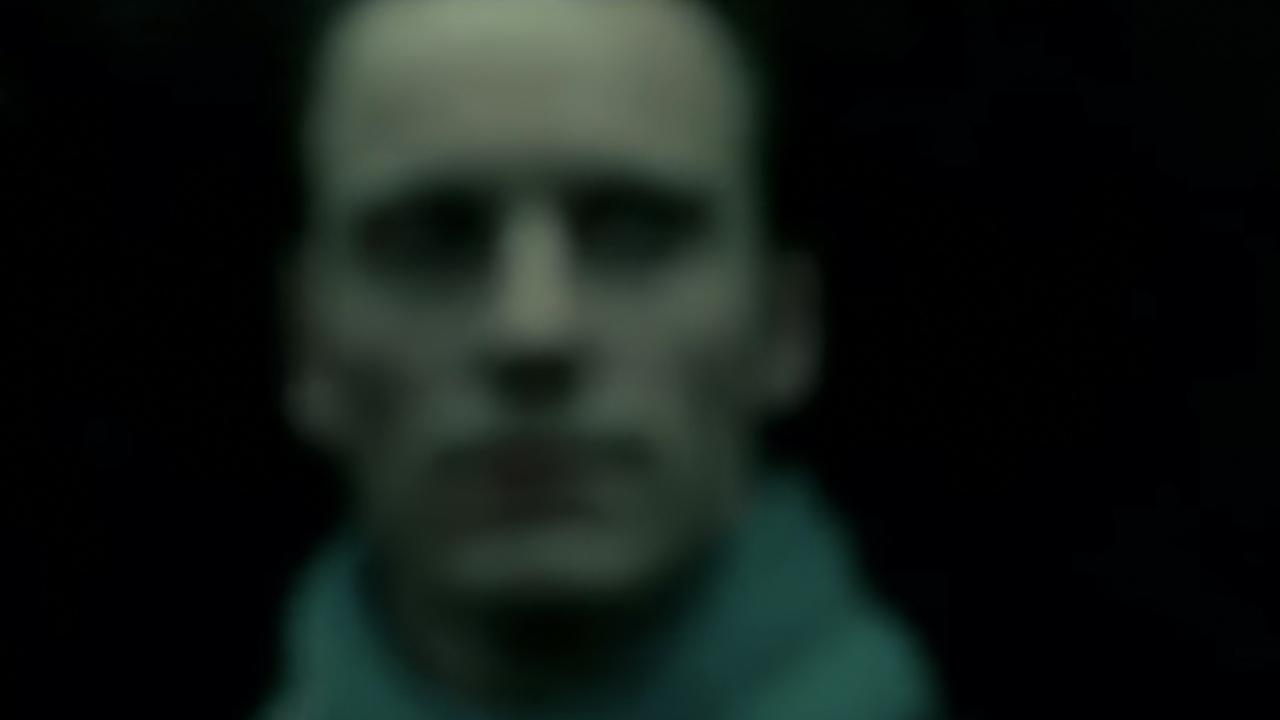Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen von Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Heute geht es um „Happy End“ von Michael Haneke aus dem Jahr 2017. Ein Familien-Drama der besonderen Art im sadistisch-subtilen Haneke-Style. Wir wünschen wie immer gute Projektion und erkenntnisreiche Lektüre.
Happy Endings, Handy Beginnings: Es war wohl nur eine Frage der Zeit, dass ein Haneke-Film endlich mal ein mediologisches Update vornimmt und die prähistorischen Videotapes (die bereits in Caché und Funny Games U.S. eigentlich schon anachronistisch waren) mit einer wesentlich zeitgemäßeren Benutzeroberfläche ersetzt: Das vertraute vertikale Display eines Smartphones mit integriertem Live-Texting rahmt die ersten Aufnahmen von Happy End als programmatischen Auftakt jenes vertrauten sadistischen Laboratoriums, das wir von Haneke kennen und erwarten. Mit vier Handycam-Takes von der Abendtoilette einer Frau zur sukzessiven Vergiftung eines Hamsters und dem Tablettentod derselben Frau geht Bennys Video nun in die mörderischen Handy-Hände der 13-jährigen Eve Laurent über (grandios: Fantine Harduin), die hier gerade dabei ist, sich Haustier und Mutter zu entledigen. Man sollte sich den Reflex unbedingt verkneifen, hier die neueste Auflage von Hanekes moralinsauerer Medienschelte serviert zu bekommen, in der nun die digitalen New Media für die emotionale Vergletscherung unserer Teenager verantwortlich gemacht werden, die durch YouTube, Facebook und Snapchat zu Serienkillern werden, anstatt zu Hause Fontane zu lesen oder Hamster zu streicheln. Als perfekter Horrorfilm-Regisseur, der Haneke immer schon war und ist, nimmt Happy End konsequent die Perspektive des bösen Mädchens ein. Und auch deshalb beginnt der Film wie ein Handy-Remake der berühmten Killer-Subjektive von Michael Myers in John Carpenters stilbildenden Slasher Halloween.
Affinität zum Horrorfilm
Überhaupt gehört es zu den großen Missverständnissen der Haneke-Rezeption, dass es seinen Filmen vordergründig um Medienkritik geht, denn das Gegenteil ist der Fall: Die vermeintliche Medienreflexivität steigert die libidinöse Immersion eher in die Gewalt, als dass sie diese mindert. Ohne gleich Haneke zu einem intellektuellen Torture-Porn-Regisseur stilisieren zu wollen: Seine Affinität zum Horrorfilm ist nicht nur in den beiden Funny Games-Filmen augenfällig, sondern auch in einem Period Piece wie Das weiße Band, der wie eine Umschrift von Village of the Damned anmutet. Überhaupt gehört das böse Kind als Figur des Horrors zum Grundarsenal von Hanekes Autorenfilmen, die eigentlich maskierte Genrefilme sind, wie Happy End nochmals eindrücklich deutlich macht. Im Unterschied aber zum historisch Bösen des vom deutschen Prä-Faschismus geborenen monströsen Infans, verzichtet Haneke in seinem Film nicht nur auf alle geschichtsphilosophischen Determinationen, sondern inszeniert das muttermordende Kind fast schon zärtlich als die einzige wahrhaft empfindsame Figur des Films. Eve ist Engel und Dämon zugleich.
Denn das großbürgerliche Familienensemble in Calais, bei dem Eve nach der Vergiftung ihrer Mutter aufgenommen wird, ist ein Kaleidoskop der Niedertracht, aus dem sich der diskrete Charme der Bourgeoisie längst verflüchtigt hat: Bürgerlich ist diese Familie, die natürlich Laurent heißt, nur wegen ihrem immensen Eigentum samt imposanten Château und arabischen Bediensteten – der Zerfall der Sittlichkeit hat nun fast schon groteske Formen angenommen: Da ist Georges, der alte Patriarch (Jean-Louis Tringtignant), der Alzheimer hat und quasi als running gag erfolglose Suizidversuche unternimmt; da ist Anne (Isabelle Huppert), die das zwielichtige familieneigene Bauunternehmen leitet, das einen fahrlässigen Unfall verursacht, das einem Arbeiter das Leben kostet. Und da ist noch Thomas (Mathieu Kassovitz), Bruder von Anne und Vater von Eve, der nach Eves Mutter eine neue Frau hat, diese aber mit einer anderen Frau betrügt, mit der er bevorzugt beim Sex-Chat urinale Fantasien auslebt. Fehlt noch Pierre (Franz Rogowski), der nichtsnutzige und leicht psychotische Sohn von Anne, der wenigstens in Momenten des Wahns diese bürgerlichen Zombies ein wenig an ihre einstigen sittlichen Habitus gemahnt. Trotz ihrer Niedertracht, ihrem Klassen- und Rassenhass, sind diese Laurents, wenngleich nicht charmant, eigentlich ganz nett und harmlos, eben wie Georges and Anne, du und ich.
Code connu statt code inconnu
Wäre es ein Film von Pasolini, müsste nun in diese Familienhölle einer verfallenden Bourgeoisie ein marxistischer Jesus intervernieren wie einst in Teorema, aber in der inerten Welt von Happy End gibt es nur noch Analogien und Ähnlichkeiten, keine Differenz, die ein Außen eröffnen würde. Dass Haneke mit den fragmentarischen Vignetten wieder scheinbar zur narrativen Form seines früheren „Code inconnu“ zurückkehren würde, erweist sich als Täuschung, denn es gibt keinen Code mehr, der geknackt werden könnte, kein Geheimnis, dass sich zuflüstern ließe, kein Abgrund, der als das postkoloniale Unbewusste eines unvernähten Blick durch den Film geistert wie in Caché. Jeder Schuss wird irgendwann durch einen, wenn auch verspäteten, Gegenschuss aufgelöst: Der Point-of-View des Smartphones wird eben bald als derjenige Eves aufgelöst, der Blick auf das Facebook-artige Fenster beim Online-Dirty-Talk entpuppt sich als diegetische Perspektive von Thomas respektive der seiner Geliebten, einer Gamben-Virtuosin.
Dass in Happy End der Kasch von Caché einkassiert ist, trifft die gegenwärtige digitale Remediation des Film präziser als etwa die gewollte Hauntology, die ein zwanghafter Hipster-Regisseur wie Oliver Assayas in Personal Shopper auf Teufel komm raus noch dem langweiligsten SMS-Getexte spiritistisch entlocken möchte. Code connu: In diesem Regime der unkaschierten Evidenzen und Sichtbarkeiten gibt es auch für den Symptomatologen Haneke nichts mehr zu entziffern und zu enthüllen. Sondern nur zu zeigen: Der Zeigegestus, der Haneke so oft als erhobener Zeigefinger vorgeworfen wird, ist in Happy End in völliger ästhetischer Immanenz zum Gezeigten. Und genauer in dieser post-hermeneutischen Immanenz liegt die besondere Qualität des Films, der sich auch in seinen ebenmäßig neutralen Digitalbildern der Flachheit einer vollkommen entzauberten Welt gleich macht.
Überraschender Zug ins Komische
Dass nach der Eloge Amour Haneke nun jede Liebe völlig eliminiert in jener Anamour dorée, die Eve in einem erbarmungslosen Dialog dem erbärmlichen Vater ganz illusionslos vorhält, muss eigentlich bei einem Regisseur nicht überraschen, dessen neue Filme seine vorangegangenen gewissermaßen dialektisch negieren. So unterminiert die Naturgeschichte des Bösen, die Das weiße Band entwirft, auf bösartige Art und Weise den leisen Geschichtsoptimismus des Endes von Caché, in der sich die Söhne gegen ihre Väter zu versöhnen scheinen. Und die furiose Schlussszene von Happy End, die mit einem politischen Kommentar zur Flüchtlingskrise in Calais eben gar nichts zu tun hat, erscheint als bittere Negation jenes Liebestods, den Jean-Louis Trintingant Emanuelle Riva in Amour „schenkt.“ Was aber überrascht, ist der Zug ins Komische, den man bei Haneke bislang so exponiert nicht vorgefunden hat, der aber als generischer Umschlag von Horror in Groteske umso zwingender erscheint angesichts der Lächerlichkeit einer bürgerlichen Gesellschaft, die eben keine bürgerliche mehr ist, sondern aus erodierten Monaden besteht - zum Pastiche verflacht, zur Grimasse erstarrt, zur Farce geworden. Dass das Ende von Happy End nur ein Handy End sein kann, versteht sich von selbst.
Dieser Text erschienen zuerst als »Code Connu. Zu Michael Hanekes Happy End« in kolik.film, Sonderheft 28, Oktober 2017.