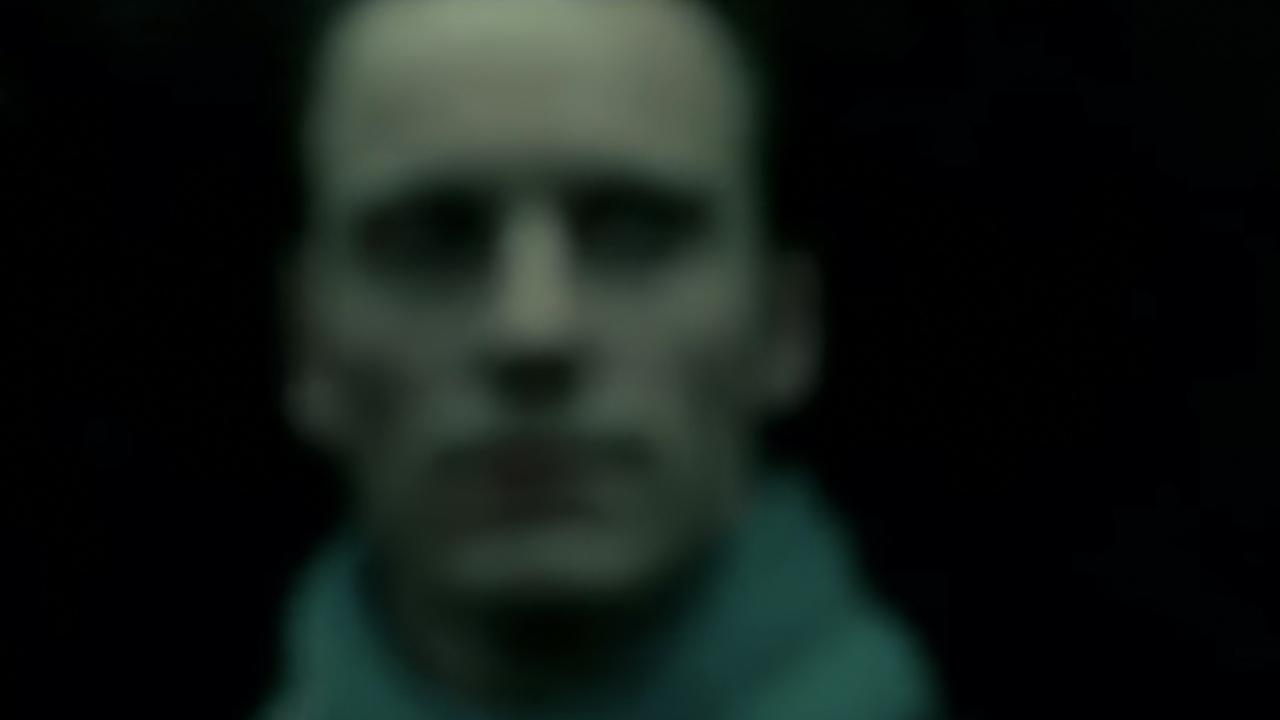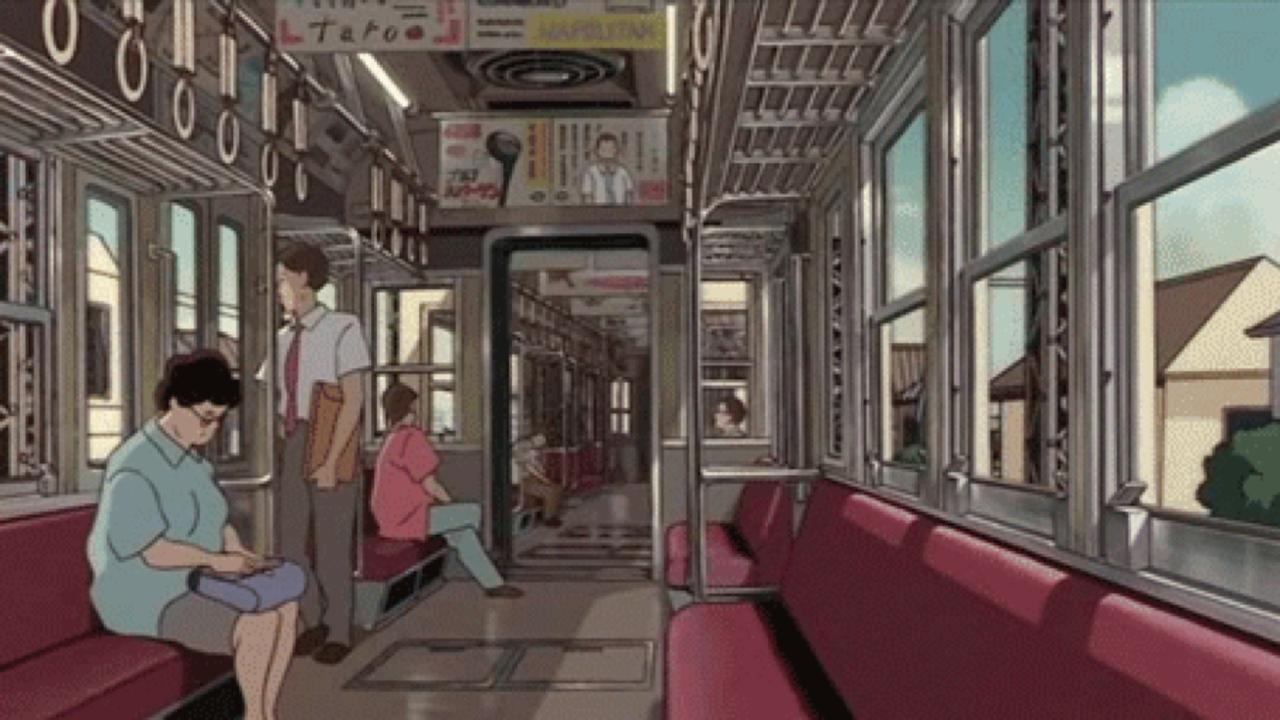Wir bleiben zu Hause, wir gucken Heimkino: Empfehlungen von Sulgi Lie für die Wohnzimmerleinwand. Heute: Ryan Gosling. In Nicolas Winding Refns sensationellem Drive gibt der gehypte Frauenschwarm den Wiedergänger von Robert De Niros Travis Bickle in Taxi Driver. Seitdem können sich alle, wirklich alle auf Ryan Gosling als perfekten Dreamboy einigen. Wieso eigentlich? Unser Filmexperte meint: weil seine sanfte Jungenhaftigkeit zugleich etwas Undurchdringliches und Unberechenbares hat. Goslings stoisches Gesicht gibt keine Innerlichkeit preis und bleibt reine Oberfläche – die perfekte Projektionsfläche für alle möglichen Sehnsüchte.
Es ist vielleicht der größte, verstörendste Moment des Kinojahres 2012: Nachdem sich Ryan Gosling und Carey Mulligan in Nicolas Winding Refns Drive über die Hälfte der Filmlänge in verhaltenster Zartheit angeschmachtet haben, kommt es endlich im Fahrstuhl zum ersten Kuss. Hypnotisch irrealisiert durch eine extreme Zeitlupe und illuminiert vom Glorienschein des Lichts: Romance pur. Und auf diesen auratischen Augenblick unschuldigen Liebesglücks folgt völlig unvermittelt ein Ausbruch brachialster Gewalt, wenn Gosling den auf ihn angesetzten Killer vor den Augen seiner Liebsten mit Stiefeltritten den Schädel zu bloßem Matsch zertrümmert. Als ob die Verklemmung der Paarbildung nur durch die Entladung der Gewalt gelöst werden könnte, wirkt Goslings Blutrausch wie eine perverse Liebeserklärung. In der Rückenansicht pulsiert die bereits ikonisch gewordene Skorpion-Bomberjacke Goslings im Atem der Erregung: Scorpio Rising.
In dieser extremen Szene vollzieht sich in Ryan Goslings scheinbar so sanftem Jungsgesicht eine unheimliche Wandlung, die dem Film ganz wörtlich einen neuen Drive gibt: Von nun an ergeht sich der Film in einer nicht enden wollenden Abfolge sadistischer Gewaltexzesse, die sich allerspätestens dann als reine B-Movie-Horrorpoetik zu erkennen gibt, wenn in einer weiteren großen Szene Gosling mit einer grotesken Stuntmaske hinter dem Fenster eines Restaurants wie ein Killer aus einem Slasher-Film auftaucht. Und wenn der maskierte Gosling in einer nachtschwarzen Panoramaeinstellung einen Gangster mit bloßen Händen im Meer ertränkt, dann ruft Drive das berühmte Ende des dunkelsten und apokalyptischsten aller Film Noirs in Erinnerung: Robert Aldrichs Kiss Me Deadly aus dem Jahr 1955. Slasher Neo Noir, könnte man das auch nennen.
Reine Psychose statt Retro-Action
Deshalb missversteht man Drive völlig, will man in ihm wie viele Kritiker nur eine weitere Stilübung im nostalgischen 80ies-Pastiche sehen. Denn trotz seiner durchgestylten Digitalbilder hat die Gewalt, die der Film entfesselt, nichts mit wohldesignter Action im Retromodus zu tun. Die Gewalt in Drive ist reine Psychose: Da mutiert der sweete Automechaniker und Stuntfahrer urplötzlich zum Schlächter, der nach einem missglückten Raubüberfall seine Gegner aufspießt, mit dem Hammer die Hand zerschlägt und Pistolenkugeln schlucken lässt. Nicht minder zimperlich ist die Gegenseite: Insbesondere der von Regisseur Albert Brooks gespielte Gangsterboss entpuppt sich als wahrer Gewaltfetischist, der seine Sammlung an exotischen Messern ganz sorgfältig in einer edlen Schatulle aufbewahrt und sich mit fast schon liebevoller Hingabe unterschiedlichen Tötungsarten widmet.
Drive ist eben nicht das Remake von Walter Hills melancholischem Driver aus den späten Siebzigern, sondern eher eine Aktualisierung von Martin Scorseses psychotischem Taxi Driver: Ryan Gosling steht weniger in der Nachfolge Ryan O’Neals, der in existenzialistischer Einsamkeit die Ethik des Professionals zelebriert, sondern ist vielmehr ein Verwandter von Robert de Niros Travis Bickle, der sich als „Gottes einsamster Mann” in den Wahnsinn der Gewalt hineinsteigert. Wenn Gosling nach dem finalen Mord an dem Mafiaboss blutüberströmt wieder in die Nacht von Los Angeles fährt, als sei nichts gewesen, gemahnt er nicht nur an Travis Bickle, sondern er wird vollends zum untoten Todesengel, der nicht sterben kann. Daher sollte man den „Drive“ des Titels ganz wörtlich nehmen: nicht als Bewegungsdynamik motorisierter Action, die in dem Film sowieso nur ganz sparsam vorkommt, sondern als Trieb, der immer auch Todestrieb ist.
Mann mit Maske
Ryan Gosling ist der perfekte Schauspieler für diesen Death Driver, weil seine sanfte Jungshaftigkeit zugleich etwas Undurchdringliches und Unberechenbares hat. Sein stoisches Gesicht gibt keine Innerlichkeit, keine Charakterpsychologie preis und bleibt reine Oberfläche, so maskenhaft wie die Maske, die er selber trägt. Der zum Hit gewordene Titelsong von Drive scheint davon zu wissen, wenn es im Refrain von Kavinskys „Nightcall” heißt: “There’s something inside you. It’s hard to explain. They’re talking about you boy. But you’re still the same.”
Gosling ist immer dann am besten, wenn Regisseure wie Winding Refn diese Maskenhaftigkeit nicht zu kaschieren versuchen und in falsche Indie-Expressivität überführen wie Derek Cianfrance in seinem larmoyanten Blue Valentine, in der sich Gosling in einer Beziehungskiste mit Michelle Williams zerfleischt. Obwohl Gosling seine Roots im Independent-Kino hat, steht ihm der Mainstream meist besser zu Gesicht. Erstaunlicherweise ist das jüngst selbst einem Langweiler wie George Clooney gelungen, der in seinem Wahlkampfdrama The Ides of March Gosling als aalglatten Karrieristen besetzt hat und zum ersten Mal auch keine Scheu davor hatte, sich selbst als Arschloch zu inszenieren und nicht wie sonst als linksliberalen Moralisten. Am Ende des Films lächelt Gosling eiskalt in die Fernsehkameras: Die Charaktermaske ist endgültig zu seinem wirklichen Charakter geworden.
Vorliebe für derangierte Figuren
Bei all dem Hype um Gosling als neuen Superstar und Frauenschwarm, den eine mittelmäßige Romantic Comedy wie Crazy, Stupid, Love fast schon parodiert, sollte man nicht vergessen, wie oft er in seiner Karriere gestörte und verstörte Figuren gespielt hat: einen jugendlichen Soziopathen in Murder by Numbers, einen manisch-depressiven Künstler in Stay, einen autistischen Sonderling, der sich in eine Sexpuppe verliebt in Lars and the Real Girl und den labilen Millionärssohn in All Good Things. Angesichts dieser auffälligen Vorliebe für derangierte Figuren wirkt Gosling fast schon bieder, wenn er in konventionellerer Weise als romantischer Lover wie in The Notebook oder als anständiger Anwalt wie in Fracture besetzt wird.
Drive ist all diesen mehr oder minder interessanten Filmen so haushoch überlegen, weil er die Psychopathologie des Ryan Gosling in abstrakte audiovisuelle Körperzeichen übersetzt: das gedämpfte, fast schon ambient-artige Sprechen, das fetischistische Knirschen der Lederhandschuhe, das leichte Zittern des Körpers nach der Gewalt. In einer tollen Flashforward-Montage gegen Ende sitzen sich Gosling und der kranke Bösewicht im Restaurant gegenüber, während sie sich im nächsten Schnitt bereits auf dem Parkplatz mit Messern abstechen. Im Flashforward des Drives gibt es keinen Anfang und kein Ende, keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr. Wir müssen uns Ryan Gosling als einen Untoten vorstellen: Scorpio Zombie.
Dieser Text erschien zuerst in De:Bug Ausgabe 161.