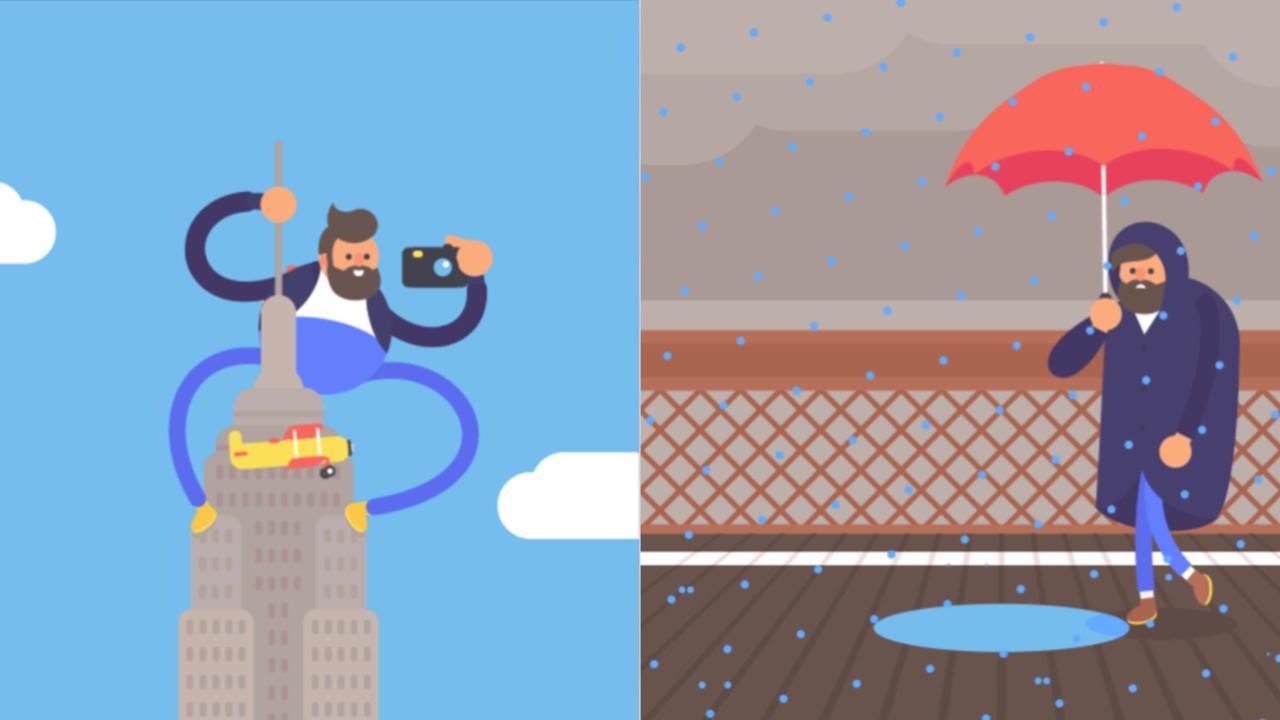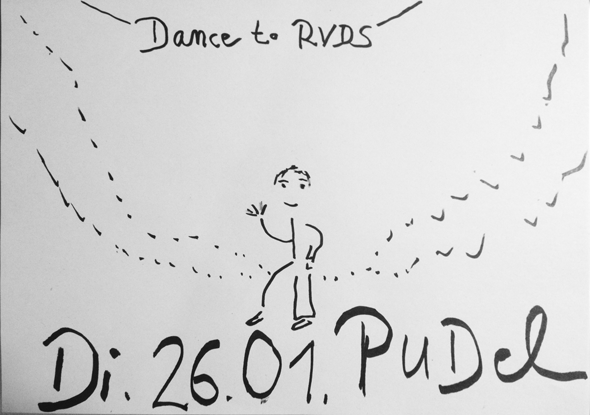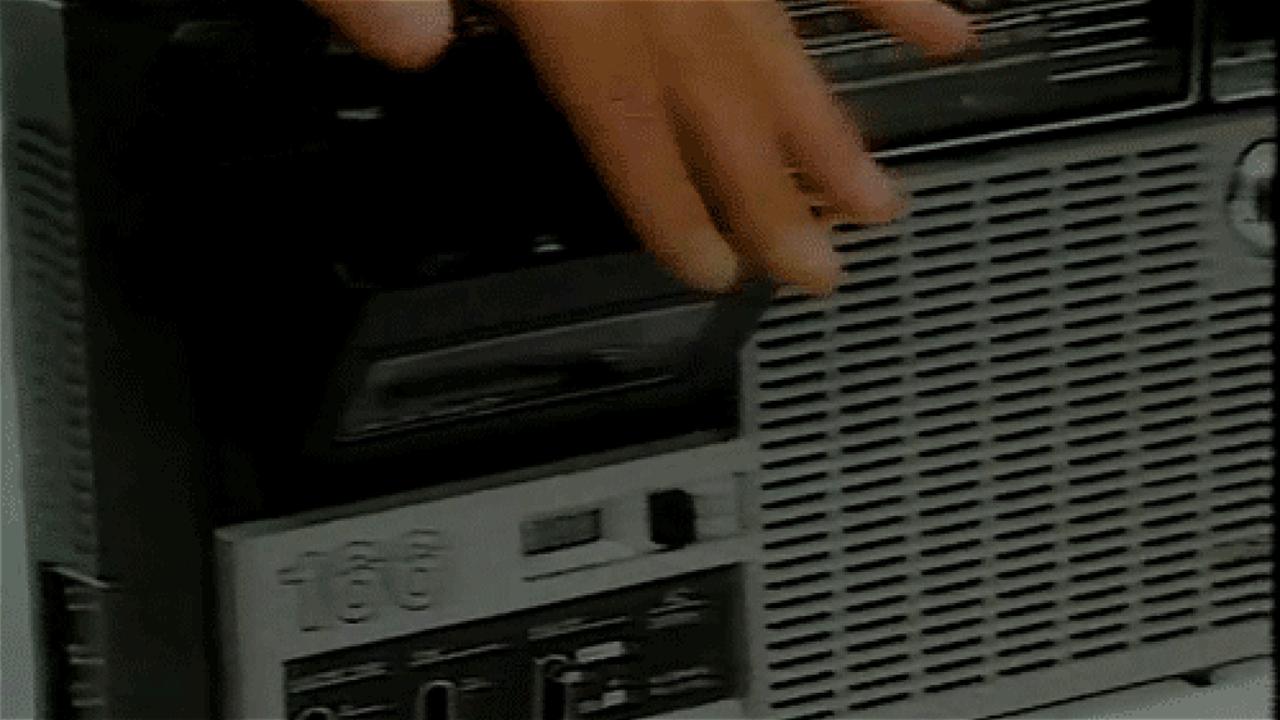Fragmente einer GroßstadtDie geraubte Tasche
17.2.2016 • Leben & Stil – Illustration und Text: Kristina Wedel
In einem Restaurant am Schlesischen Tor, es heißt Schlesisch Blau, sitze ich mit vier Personen an einem gemütlichen Tisch vor meinem heißen Teller roter Tomatensuppe. Drei dieser Menschen sind mir nahezu fremd bis fremd: ein gut gelauntes Ehepaar, er Ende 50, sie Ende 60, und ihr noch besser gelaunter langjähriger Freund, der Besitzer des Restaurants. Die vierte Person ist mein Freund.
Der Grund, weshalb wir uns in dieser Konstellation an diesem Abend in diesem Restaurant wiederfinden, ist so angsteinflößend wie absurd und zugleich herzerwärmend schön. Genug Gründe, um die Geschichte aufzuschreiben:
Vor ein paar Wochen auf dem Weg ins Office – ich war zu Fuß unterwegs – sah ich an einer Straßenecke auf dem äußeren Fensterbrett zwei Männer in einer Tasche wühlen. Erstmal lief ich ein paar Meter weiter, um mir das aus einer sicheren Entfernung anzusehen. Offensichtlich war die große Beute bereits abgegriffen, die Wühler blieben leer aus. Mir war gerade nicht nach einfach so weitergehen und andere machen lassen. Deshalb rief ich die beiden zurück und fragte sie, wonach sie gewühlt hatten und woher die Tasche kam. Sie hätten sie am Straßenrand im Schnee gefunden, gerade eben. Es sei nichts mehr drin, sie hätten nichts mitgenommen, sie hätten ja Arbeit! Meine Beobachtung und der Eindruck, den sie mir vermittelten, ergaben zusammen ein schlüssiges und wahres Bild, was die Unschuld der Wühler anging. Sie zogen von dannen.
Ganz und gar nicht schlüssig war, was es mit der Tasche auf sich hatte. Ich nahm mich ihrer an – überfordert von ihrem Gewicht der Verantwortung – wie bei einem Findelkind, das soeben ausgesetzt wurde. An einem Ende des Henkels war sie sauber durchtrennt. Raub! Sie sah eher nach einer Herrentasche aus. Ein Blick ins Innere, eher vorsichtig suchend als wühlend, bestätigte das. Führerscheine, ADAC-Karten, Schlüssel, ein leeres Portmonee, Papierkram, Reisepass … die volle Bandbreite.
Endlich im Büro angekommen recherchierte ich aufgeregt den Namen im Internet. Nichts! Nichts? Dass es sowas noch gibt, einen Menschen, der keine Spur im Netz hinterlässt. Super, aber für mich äußerst ärgerlich. Letzte Chance vor dem Gang zur Polizei: ein Hausbesuch. Die Adresse stand ja auf dem Personalausweis.
Kreuzberg. In einer Seitenstraße zwischen Kotti und Görli fand ich den Namen an der Klingel. Die Tür summte, ich ging rein und nach oben. Der überraschte, ängstliche Blick eines Mannes empfing mich an der Wohnungstür. Ich hätte da was für ihn, und holte die Tasche hervor. Völlig perplex stand er da. Seine Frau kam dazu und bat mich überschwänglich hinein. Sie sprang aufgeregt hin und her, zwischen Kundtun ihres Dankes und Entschuldigen dafür, dass sie mir keine Pralinen anbieten könne.
Er erzählte: In der vergangenen Nacht – er feierte in einer Kreuzberger Kneipe in seinen Geburtstag rein – wurde er vor dem Aufschließen an seiner Haustür gekonnt kurz von hinten bis zur Ohnmacht gewürgt. Es ging alles ganz schnell, er konnte niemanden erkennen. Als er aufwachte, war er komplett ausgeraubt. Danach hatten sie sich wohl die Rosinen rausgepickt und alles Überflüssige weit abseits vom Tatort auf die Straße geworfen.
Nun war das nette Ehepaar immer noch fassungslos. Und traurig, dass sie die Geburtstagsgäste für den Abend ausladen mussten. Mich wollten sie aber gern einladen. Ich sehe jung und studentisch aus, könne sicher etwas Geld gebrauchen. Ich wolle nur Karma-Punkte, sagte ich. Dann aber eine Einladung zum Essen! Das Geld, was sie nun nicht für die Neubeantragung der Ausweise ausgaben, sollten wir gemeinsam auf den Kopf hauen. Meinen Partner solle ich mitbringen.
Zwei Wochen später sitzen wir nun hier im Schlesisch Blau. Gut gelaunt. Wir unterhalten uns über Berlin und die Welt von damals und heute, David Bowie, Ängste, Kleingartenanlagen und Schnapsetiketten. Wir beschließen, uns wiederzusehen.
Kristina Wedel ist freie Illustratorin und lebt in Berlin-Neukölln. Wo andere ihre Smartphones mit nie wieder angesehenen Fotos füllen, hält sie ihren Stift – vorzugsweise einen einfachen, schwarzen Muji-Pen – bereit und zeichnet jene Eigenarten des urbanen Alltags, die sich nicht so leicht ablichten lassen. Für Das Filter erzählt sie jeden zweiten Mittwoch die Geschichten hinter ihren Bildern.