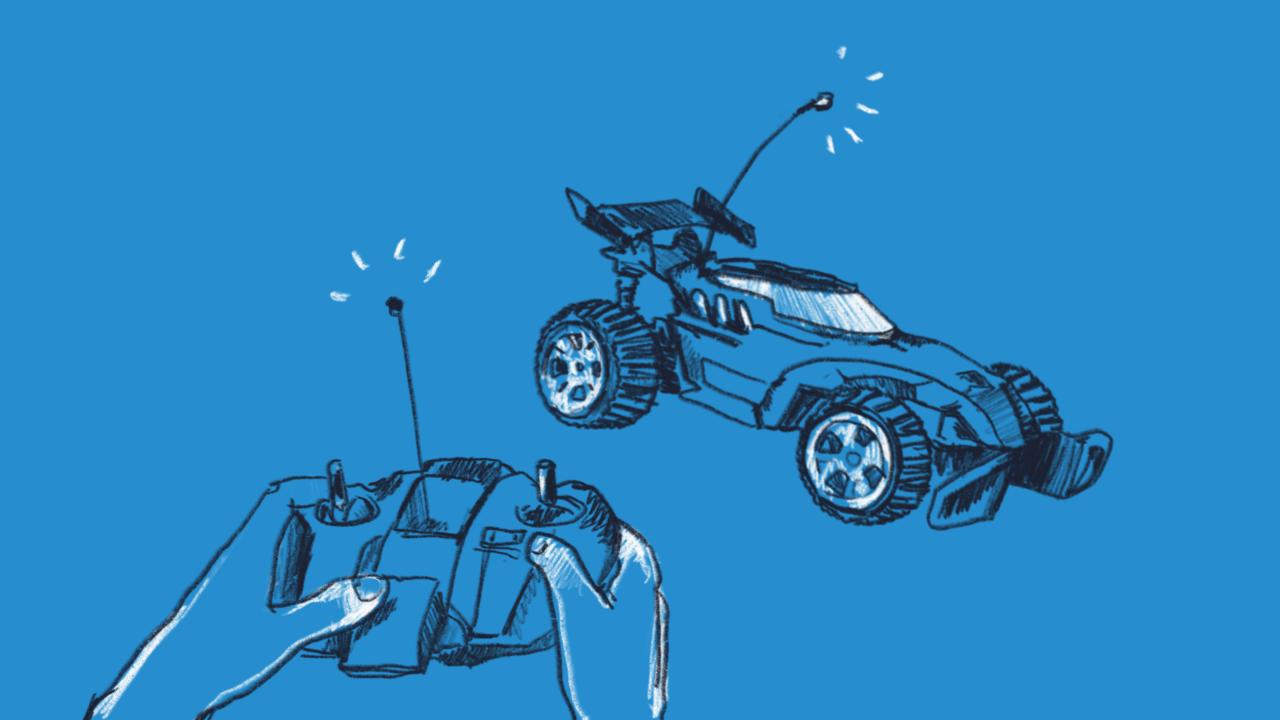„Ein Refugium, an dem sich der Film neu erfinden kann“So war das Filmfestival Marseille – Teil 2
12.8.2016 • Film – Text: Henrike Meyer
Foto: Empathy © Jeffrey Dunn Rovinelli
Im zweiten Teil von Henrike Meyers Festivalbericht aus Marseille geht es um eine performative Dokumentation, um einen Film, bei dem exzessiv in die Kamera geschaut wird, und um ein minimalistisches Porträt einer Gruppe autistischer Kinder aus den USA.
##Empathy
Sehr beeindruckt hat mich auch Empathy von Jeffrey Dunn Rovinelli. Der Regisseur bezeichnet seinen Film als „performative Dokumentation“. Empathy zeichnet ein intimes und zärtliches Bild der Protagonistin Em, einer jungen Frau, die ihr Geld im Escort Business verdient. Der Film – 16mm mischt sich mit HD-Aufnahmen – begleitet sie auf ihren Stationen durch die USA, bei dem Versuch clean zu werden: New York und Pittsburgh im Winter, am Ende das sonnige Los Angeles. Die Ortsnamen betiteln die einzelnen Kapitel des Films, in denen Situationen aus dem Leben von Em Cominotti durchgespielt werden – mit ihr selbst in der Hauptrolle. Die Grenze zwischen Spiel- und Dokumentarfilm lässt sich nicht klar ziehen. Davon lebt der Film. Em Cominotti ist selbst die Erzählerin ihrer Geschichte. Gemeinsam mit dem Regisseur hat sie das Buch geschrieben und ist zudem Ko-Produzentin des Projekts. Der Titel Empathy stammt von einem Tattoo über ihrem Bauchnabel.
Am Anfang – die Titel werden noch über das Schwarzbild eingeblendet – hören wir ihre Stimme im Off. Die Narration wird kurz umrissen: Escort, Heroinsucht, NYC und Pittsburgh. Nach einem sehr langsamen Schwenk, der uns auf viele kommende lange Einstellungen vorbereitet, sehen wir Em in ihrem Bett liegen. Sie erwacht aus einem fiebrigen Schlaf. Der Raum öffnet sich – die Wohnung wird in statischen Bildern erzählt – mit einem Augenmerk auf Details, die Einblick in ihr Privatleben geben. Ein Freund macht ihr einen Kaffee. Sie erzählt ihm von ihrem Versuch runterzukommen.
Wir sehen sie wie sie ihre Sachen packt und mit der U-Bahn zur Arbeit in ein Hotel fährt. Sie macht sich im Bad zurecht und ist kaum wiederzuerkennen. Wieder sind es Details, die uns die Hard Facts geben: Geld und Kondome auf dem Nachttisch. Dennoch ist die Begegnung mit dem Kunden alles andere als hart und kalt, wie man es vielleicht aus anderen Filmen kennt. Bevor sie Sex haben, liest er ihr Gedichte vor. Ihre Beziehung erscheint vertraut und liebevoll.
Besonders stark war für mich die Präsenz der Darstellerin. Sie wirkt natürlich und gleichzeitig distanziert. Viele Gesichter hat sie. Auch wenn sie Intimes preisgibt, wirkt es nie zu nah.
Der narrative Bogen, das Annehmen ihrer eigenen Rolle, ist dabei ein wichtiges Element. Sie ist als souveräne Erzählerin spürbar. Dabei ist es interessant zu beobachten, welche Situationen gespielt werden oder dokumentarisch sind und welche als Erzählungen in den Film eingehen. Von den Phasen, in denen Em mental und physisch am Ende ist, erfahren wir in einem gedrehten Skype-Gespräch, von einer sicheren Warte aus. Auch die Bilder stellen nichts aus oder zur Schau. Ihre Heroinsucht wird z.B. nie direkt abgebildet, nur die Spuren werden sichtbar. Mal sind die Einstichstellen deutlich zu sehen, dann werden sie überschminkt vor der Arbeit, mal scheinen sie verheilt.
Wir erfahren viel über ihr Leben und die Umstände, die es bedingen. So wird auch ein Bild eines Lebens in den heutigen USA gezeichnet. Was es heißt, abhängig zu sein, vom Geld, mit dem man die Miete und Krankenversicherung zahlt – von einer Droge und anderen Menschen.

Max Turnheim 2001-2015 © Friedl vom Gröller, sixpack film
##Max Turnheim 2001-2015
Friedl vom Gröllers Film Max Turnheim 2001-2015 ist der 14. Teil eines fortlaufenden Porträts eines jungen Mannes im Verlauf verschiedener Phasen seines Lebens. Der Film ist stumm, das Material 16mm und schwarzweiß. Die statische Aufnahmen erinnern an klassische, fotografische Porträts – haben aber das Moment der Dauer.
Am Anfang sehen wir eine Familie: Vater, Mutter und zwei Jungen. Im Verlauf des Films rückt der ältere Sohn ins Zentrum. Es sind Augenblicke seines Lebens. Einschneidende Momente, wie der Tod des Vaters, erzählen sich in Auslassungen: Nach einer Einstellung im Krankenhaus bleibt in einer folgenden ein Platz am Tisch leer. Später: Max und seine Freundin, ein junges Liebespaar. Beide halten den Blick in die Kamera – man spürt genau wie sie sich anschauen wollen. Das ist schön zu sehen! Dann Max als Vater. Max bei der Arbeit. Stationen des „Erwachsenwerdens“. Und immer wieder der Blick in die Kamera. Seine Augen, vielleicht grün oder blau, hell sind sie. Ein durchdringender Blick, ernsthaft. Das Leben außerhalb der Einstellungen liest sich darin.
Was im Spielfilm immer „verboten“ ist, das „In-die-Kamera-schauen“, ist hier Essenz. Sechs Augenpaare: der Mensch vor der Kamera, der dahinter und ich als Betrachter. Pupille und Linse, beides schwarze Löcher – Öffnungen für Aufnahme. Und das Bild als Schnittfläche dazwischen in rechter Spannung. Über die Dauer des Blicks baut sich etwas auf, ein Vertrauen ist spürbar. Die Offenheit etwas preiszugeben und gleichzeitig bleibt doch ein Geheimnis. Wir treten in einen Dialog, ein stummer Austausch. Es wird etwas Zwischenmenschliches verhandelt mit den Mitteln des Films.
Es ist ganz wunderbar, was uns Friedl vom Gröller ermöglicht: Einem Anderen, Fremden zu begegnen. Sein Gesicht betrachten zu können über diese Dauer. Im „echten“ Leben ist das nur Liebenden vorbehalten.

Scrapbook © Mike Hoolboom
##Scrapbook
Der letzte Film, den ich in Marseille gesehen habe, hat mich am meisten bewegt. Auch bei Scrapbook von Mike Hoolboom musste ich viel über den Blick in die Kamera und was es heißt, ein Bild zu machen, nachdenken. Formal ist dieser 18-minütige Film minimal: schwarzweißes 16mm-Material, Texttafeln, die seine Entstehung erläutern, eine abstrakte Soundebene und ein Voice-Over. Wie die Dinge angeordnet sind, wie sie sich zueinander verhalten, wovon sie erzählen und auf welche Art und Weise, ist wahnsinnig beeindruckend. Der Film ermöglicht einen Zugang zu einer Welt, die sonst verschlossen ist. Auch Tage nach dem Festival habe ich den Film noch lebendig in Erinnerung.
Das Filmmaterial hat ein Freund Hoolbooms, Jeffrey Paull, 1966 während eines Filmworkshops in einer Einrichtung für autistische Kinder und Jugendliche in den USA gedreht. Die Teilnehmer haben damals gelernt, mit einer Kamera Bilder von sich zu machen und sie selber zu entwickeln. „In order to re-see themselves.“ Diese Erfahrung war für viele therapeutisch.
An einem Tag brachte Paull seine Bolex mit und schoss ungefähr 30 Minuten Material. Es sind vor allem Porträts der Kinder und Jugendlichen: Blicke in die Kamera, ein Lächeln, sie machen Faxen.
Auch der Alltag wird sichtbar: Eine Betreuerin mit einem Jungen auf dem Schoß, er schmiegt seine Wange immer wieder an ihre, ein anderer liegt im Sonneneinfall eines Fensters, selbstvergessen. Ein Kind isst eine Torte und sieht selig aus. Ziemlich am Anfang grinst ein Mädchen mit Brille in die Kamera. „Oh, it’s you“, hören wir aus dem Off. Es ist Donna Washington. 50 Jahre nachdem die Aufnahmen entstanden sind, hat Hoolboom im Internet nach den Teilnehmern von damals gesucht. Donna meldete sich und war bereit, sich das Material noch einmal anzusehen. Ihre Reaktionen wurden auf Tonband aufgenommen und zu einem Text zusammengefügt. Diesen hören wir als Voice-Over, gesprochen von einer Schauspielerin. Das Script des Films lässt sich übrigens auf der Internetseite des Regisseurs finden.
Ihre Worte sind Poesie. Sie spricht über das Mädchen mit der Brille, das sie auf den Bildern sieht, in einer Art und Weise, die klassische Konzepte von Selbstbildern und Wahrnehmungen in Frage stellen. Ihr „Ich“ ist keine geschlossene Form. Die Grenzen zum Außen sind fließend, durchlässig. Die Eindrücke der Umwelt sind so stark und lebendig. Sie kann sich mit einer Farbe, einem Gegenstand, Dingen im Raum identifizieren, nimmt sie an, wird zu ihnen. Was in schamanistischen Ritualen zeitweise erfahrbar ist, war für sie ein permanenter Zustand. In der Konfrontation mit der Kamera und den Gesprächen mit Jeffrey Paull passierte etwas Neues. Über die Arbeit mit Bildern entdeckte sie eines, das sie ihr eigenes nennen und annehmen konnte. Dieses Bild ist sie geworden. Darüber hat sie eine Sprache für sich gefunden. Es ist sehr berührend wie sie am Ende sagt, dass sie die Angst vor den Gesichtern der Anderen verloren habe, da sie in ihnen auch ein Stück „Ich“ finden könne.
Ihre Worte sind so genau und offen zugleich. Wahrhaftig, voller Schönheit und Humor. In der Auseinandersetzung mit dem Bild macht sie Aussagen über das Filmemachen und das Kino und das, was uns Menschen alle eint.
Am Ende bleibt natürlich die Frage – wie kann man diese Filme sehen? Im Kino höchstwahrscheinlich nicht, was sehr schade ist! Sie schwirren im Festivalkosmos. Es ist gut, dass es Orte wie Marseille gibt. Refugien, an denen sich der Film neu erfinden kann.
Den ersten Teil von Henrikes Festivalbericht aus Marseille findet ihr hier.